 KRISTIAN BISSUTI
℗
KRISTIAN BISSUTI
℗Uwe Mauch
Die Aufarbeitung der tragischen Chance. Die Studie über »Die Arbeitslosen von Marienthal« ist aktuell wie nie. Empirischer Bericht über einen weltbekannten Ort
in: Kurier. Unabhängige Tageszeitung für Österreich (Wien) vom 14. April 2009, S. 17.
Die Veröffentlichung auf dieser Website erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Uwe Mauch, Wien. Beachten Sie das Copyright!
17
Die Aufarbeitung der tragischen Chance
Die Studie über »Die Arbeitslosen von Marienthal« ist aktuell wie nie. Empirischer Bericht über einen weltbekannten Ort.
Von Uwe Mauch
 KRISTIAN BISSUTI
℗
KRISTIAN BISSUTI
℗
Die Arbeitsbienen von Marienthal: Bürgermeister Leopold Zolles, Werksleiter Martin Petschnig, Sozialforscher Reinhard Müller und Zeitzeuge Tibor Schwab (von rechts nach links)
Die schlichte Tafel am Eingang zur alten, revitalisierten Arbeitersiedlung soll uns die Pionierin der österreichischen Sozialforschung, Marie Jahoda (1907–2001), in Erinnerung rufen: »Wir haben als Wissenschaftler den Boden von Marienthal betreten. Wir haben ihn verlassen mit dem einen Wunsch, dass die tragische Chance solchen Experiments bald von unserer Zeit genommen werde.«
Was für ein Satz!
Der Schlusssatz der Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal« hat auch 75 Jahre nach ihrer Veröffentlichung wenig an Gültigkeit verloren.

KURIER
Es war bald nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, 1929, und der daraus folgenden Schließung der örtlichen Industriefabrik. Da machte sich ein hochmotiviertes junges Forscherteam aus Wien auf den Weg nach Marienthal, einer Arbeiterkolonie im niederösterreichischen Gramatneusiedl – bis dato nur außerhalb Österreichs weltbekannt.
80 Prozent der Fabriksarbeiter hatten dort binnen weniger Wochen ihre Arbeit verloren. Die Letzten, die entlassen wurden, mussten vor ihrem Abgang noch die Maschinen demontieren.
Im Schritttempo Eindrucksvoll haben Jahoda und ihre Kollegen die Wirkungen von Arbeitslosigkeit skizziert. Für »die müde Gemeinschaft« und für den Einzelnen. Wie die Schritte der nicht mehr Gebrauchten kürzer werden, wie die ungewollte Freizeit allmählich zur Qual wird, wie Zwiebel statt Blumenzwiebel gepflanzt werden, Hunde und Katzen über Nacht verschwinden, während der Fleischer den Rückgang des Geschäfts beklagt.
Auch
Reinhard Müller, Soziologe
an der Universität Graz, bleibt vor der
Tafel stehen, um dem Bürgermeister von
Gramatneusiedl, Leopold Zolles, noch einmal die ganze Tragweite von
»Marienthal«
darzulegen: »Das ist
bis heute die wichtigste sozialwissenschaftliche Studie in Österreich,
und eine der wichtigsten weltweit.«
Zolles nickt. Fühlt
sich bestätigt. Seine Partei, die SPÖ, konnte vor einigen Jahren im
Gemeinderat (damals noch mit Zwei-Drittel-Mehrheit) die Revitalisierung
der bereits arg
ramponierten Arbeiterkolonie beidseits der
Hauptstraße durchsetzen.
Gemeinsam mit dem engagierten Soziologieprofessor, der im Vorjahr einen Schmöker über das Dorf, seine Bewohner, die Forscher und deren Studie veröffentlicht hat, will Zolles nun ein Studien-Museum eröffnen: »Dort, wo der Konsum war.«
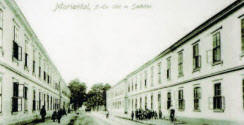 REPRO: KRISTIAN BISSUTI
REPRO: KRISTIAN BISSUTI
Arbeiterkolonie: Im Jahr der Krise, 1929, wurden hier alle arbeitslos
 KRISTIAN
BISSUTI ℗
KRISTIAN
BISSUTI ℗
Werksgeschichte: Früher wurde Seide erzeugt, heute ist es Plexiglas
Viel Arbeit mit der Arbeitslosigkeit hat in diesen Tagen auch Thomas Schwab, ein waschechter Marienthaler. Sein Vater, Tibor, hat lange »drüben im Werk« gearbeitet und lernte dort auch noch den einen oder anderen »Alten von damals« kennen. Er selbst ist Betriebsrat und schreibt nebenbei eine Diplomarbeit, die sich ebenfalls mit dem Thema Nummer 1 beschäftigt. Im Zuge seiner Recherchen musste er feststellen, dass die Arbeitslosigkeit im Ort zuletzt deutlich angestiegen ist.
 PRIVAT
PRIVAT
Nachfahre: Thomas Schwab (re.)
Ehrenamtlich Noch sind die Schrittlängen der Marienthaler nicht kürzer als vor einem Jahr. Und Hunde und Katzen müssen nicht um ihr Leben bangen. Dafür sorgt auch »das Werk drüben« – »die Para-Chemie«, ein Plexiglas herstellender Industriebetrieb. Prokurist Martin Petschnig kann den deutschen Eigentümern in Essen längst keine Jubelmeldungen mehr liefern, will aber auch keine Verhältnisse wie in den Dreißigerjahren orten: »Auch wir haben gewisse Absatzprobleme, doch wir sind ein recht gesundes Unternehmen, wir mussten bisher keinen einzigen Mitarbeiter kündigen.«
Leidvoll die Geschichte, ungewiss die Zukunft von Marienthal. Einstweilen wird es Abend. Reinhard Müller will über Nacht bleiben, um bei einem Dokumentarfilm über die Arbeiterkolonie beratend mitzuwirken. Viele Details zur Studie weiß er zu erzählen: Dass eine brisante Sozialreportage über Marienthal, erschienen in einem Parteiblatt der Sozialdemokratie, die Forscher hellhörig gemacht hat. Oder: Dass Marie Jahoda nach Abschluss der Studie erneut mit der Bahn anreiste. Nicht als Wissenschaftlerin, sondern als ehrenamtliche Helferin.
Fernziel des Grazer Soziologen Reinhard Müller ist die Einrichtung einer Sommerakademie in Marienthal – für alle Sozialwissenschaftler in der Tradition von Jahoda, die früh erkannt hat, dass eine wissenschaftliche These, die sich nicht alltagssprachlich ausdrücken lässt, nicht allzu viel wert ist.
Vertrieben
Eine typisch österreichische Geschichte
Mit der »Marienthal«-Studie werden meist nur die drei Namen der auf dem Buchcover der späteren Ausgaben genannten Sozialforscher in Verbindung gebracht:
Paul F. Lazarsfeld, seine damalige Frau Marie Jahoda und Hans Zeisel.
Der Grazer Studien-Biograph Reinhard Müller verweist dagegen auf den Team-Charakter bei der Durchführung, der Auswertung und der Präsentation der Forschungsergebnisse: »Insgesamt waren neun Forscherinnen und sechs Forscher am Projekt beteiligt.«
Der Faschismus vertrieb die jungen Akademiker aus Österreich. Lazarsfeld ging bereits im Jahr 1935 in die USA, Jahoda im September 1937 nach England, Hans Zeisel flüchtete im März 1938 vor den Nationalsozialisten nach Washington. Alle drei konnten im Exil Karriere machen.
Ihre Arbeiten zählen in der angelsächsischen Sozialwissenschaft bis heute zu absoluten Klassikern. Nach ihrem unfreiwilligen Umweg wurden Lazarsfeld und Co. in ihrem Heimatland wieder entdeckt. Das offizielle Österreich wollte seine Vor-Denker erst an ihrem Lebensabend angemessen ehren.
Mediathek: Viel tut sich rund um die klassische Studie
Bestseller Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld und Hans Zeisel: »Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkung langanhaltender Arbeitslosigkeit.« Edition Suhrkamp. Lesenswerte, leistbare Pflichtlektüre für Soziologie-Studenten. Erscheint in Kürze in der 22. Auflage. ISBN 978-3-518-10769-0. 8,30 €.
Schmöker Reinhard Müller: Marienthal. Das Dorf – Die Arbeitslosen – Die Studie. Studienverlag. 423 Seiten geballte Rundum-Information. ISBN 978-3-7065-4347-7. 41,10 €.
Homepage Für Interessierte hat Müller auch eine eigene Internet-Seite eingerichtet: http://agso.uni-graz.at/archive/marienthal
TV-Doku 3sat zeigt am 13. Mai, ab 21.05 Uhr die neue TV-Doku über Marienthal – von ORF-Redakteur Günter Kaindlstorfer
Veranstaltung Am 14. Mai, ab 12 Uhr im Gemeindezentrum Gramatneusiedl: Experten-Hearing zum Thema Gesundheitsförderung für Arbeit-Suchende. Nähere Infos: www.fit-start.at