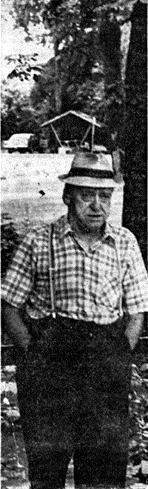
Walter Kratzer
Nichts Neues in Marienthal.
in: AZ mit Beilage. Arbeiter-Zeitung (Wien), [83.] Jg., Nr. 175 (31. Juli 1971), AZ Wochenende, S. I & V.
Beachten Sie das Copyright!
I
Nichts Neues in Marienthal
Unsere Welt verändert sich. Aber verändert sie sich überall? Überall gleich? Oder an manchen Orten, an Orten, die vielleicht nur ums Eck liegen, vielleicht gar nicht, oder kaum, oder nicht grundlegend, das heißt eigentlich nur an der Oberfläche? Es gibt wenig Möglichkeit, das festzustellen; entweder, weil das Material über das Gestern zu komplex, die Räume, die da gefaßt werden, zu groß sind, oder weil Material gar nicht da ist, insbesondere nicht über Mikrokosmen, bei denen der Vergleich zwischen gestern und heute sozusagen mit einem Blick zu erfassen wäre, bei denen Unterschiede zwischen gestern und heute an Familien zu messen wären, an Häusern, an Straßenzügen und Industrien.
Aber manchmal kann man es doch versuchen. Als vor einigen Wochen der Wiener Soziologe Paul F[elix] Lazarsfeld, heute Professor an der Columbia-Universität in New York, in Wien das Ehrendoktorat erhielt, fiel Walter Kratzer eines seiner Werke in die Hand, die Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal«, die er gemeinsam mit Marie Jahoda und Hans Zeisel im Jahre 1931 erarbeitet hat. Hier war der beschriebene Mikrokosmos der Vergangenheit. Und sogleich tauchte die Frage auf: Was ist aus diesem Marienthal, diesem winzigen Fleckchen niederösterreichischer Erde geworden in diesen vierzig Jahren? Was sind die Marienthaler geworden, einst harte Streiter für das Recht ihrer Klasse? Hat man Hochhäuser an die Stelle der Arbeiterbaracken gebaut, die Lazarsfeld in seiner Studie beschrieb? Hat neue Industrie den Ort, in dem damals gerade jene Fabrik demontiert wurde, die ihn geschaffen hatte, neues Leben gebracht? Sind die Menschen arbeitslos wie damals, hungrig und gleichmütig?
Nein, das nicht, keine Hungrigen und keine Arbeitslosen in Marienthal, aber das Sterben, das damals begann, es ist noch nicht zu Ende – und in diesem Sinne ist Marienthal geblieben, was es war.
*
»Dort, wo die neuen Häuser aufhören, beginnt Marienthal«, hatte mir eine ältere Frau gesagt, die mit mir die 26 Minuten mit der Ostbahn nach Gramatneusiedl gefahren war, Marienthal ist ein Teil dieses Ortes.
»Ein paar hundert Meter stehen rechts und links von der Landstraße statt der Häuser kleine Buden, dann ist man in Marienthal«, heißt es in dem Buch über Marienthal. »Einförmig wie die Gegend ist der Ort. Die Häuser sind langgestreckt, einstöckig, alle nach demselben Muster gebaut. Abseits von der Landstraße stehen ein paar Baracken, denen man anmerkt, daß sie seinerzeit schnell fertig werden mußten, um den plötzlichen Arbeitszuwachs aufzunehmen. Nur das ehemalige Herrenhaus, das Fabriksspital und das Beamtenhaus ragen zweistöckig über die anderen hinaus. An der Fischa hinter den Häusern stehen zwei große Schlote, umgeben von lang hingestreckten, zum Teil verfallenen Mauern: die Fabrik.«
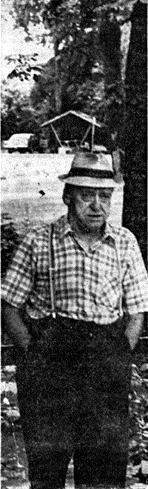
Karl Petsch [recte Peč; Anm. R.M.]. Er war schon immer da
EIN STILLER ORT
Sonntag vormittag in Marienthal. Auf der staubigen Ortsstraße fährt kaum ein Auto; die Marienthaler sitzen vor den Häusern, die die Straße säumen, in der Sonne. Zwischen den alten Arbeiterwohnhäusern plätschern Brunnen. Das Mauerwerk bröckelt. »Die Brunnen rinnen schon, seit es Marienthal gibt«, erzählt die alte Frau auf der Bank. »Tag und Nacht. Das kommt von einer Quelle. Es kommen manche Leute mit dem Auto her, um sich das Wasser mit dem Kanister zu holen.«
MAUERRESTE UND »URWALD«
Und hier, zwischen Mauerresten und Gestrüpp, führt ein schmaler Feldweg zum ehemaligen Park von Marienthal, heute fast ein Urwald. »Früher hat es im Park eine Kastanienallee gegeben, einen Goldfischteich, Bänke und Wiesen«, erinnert sich die alte Frau. »Das war wunderschön. Das hat alles der Herr [Hermann] Todesko gemacht.«
Die Zeit steht in Marienthal. Man weiß hier noch von Hermann Todesko, dem Gründer von Marienthal. Todesko hat sich im Park ein Denkmal gesetzt. Einen Engel, der krampfhaft einen Steinkrug umklammert, mit einer Gedenktafel. Die Buben von Marienthal haben vor einigen Jahren der Figur die Arme abgesägt. Die Gedenktafel war schon früher verlorengegangen. Der Name Marienthal aber ist geblieben. »Der hat das alles nach seiner Frau Marienthal genannt«, sagen die Buben. Auch sie wissen noch von Todesko. Sie spielen Fußball in dem Urwald, den die Alten noch »herrschaftlichen« Park nennen.
FABRIK AM FLUSS
[Hermann] Todesko ist, das wissen selbst die Schulkinder noch, 1830 auf der Suche nach einem geeigneten Platz für eine Flachsspinnerei nach Gramatneusiedl gekommen. Außerhalb von »Gramat« war nichts. Dann war dort Marienthal – bis heute, denn die Fischa-Dagnitz, die dort fließt, friert auch im strengsten Winter nicht, das gab den Ausschlag damals. Hier entstand der älteste Teil der Fabrik. Deutsche, böhmische und mährische Arbeiter zogen in die Arbeiterhäuser. Eine Baumwollspinnerei kam dazu und neue Arbeiterhäuser. »Die Geschichte dieser Fabrik«, heißt es in der Studie, »ist so zugleich die Geschichte des Ortes.«
Um 1860 kamen eine Weberei und die Bleiche hinzu: Die Fabrik wurde ein Großbetrieb – und die Arbeiter wurden wach. Die ersten Arbeiterorganisationen und Vereine entstanden. Entlassungen gab es kaum in der Zeit der kapitalistischen Prosperität – wer einmal in Marienthal war, wurde mit Frau und Kindern in der Fabrik beschäftigt. Aber die Löhne waren knapp, auch die Kinder arbeiteten acht Stunden täglich in drei Schichten in der Fabrik.
DER ERSTE LOHNSTREIK
Der erste Lohnstreik 1890 wurde mit Militärhilfe niedergeschlagen. Damals blieben die kaiserlichen Dragoner sechs Wochen in Marienthal. Einige aber blieben für immer. Sie heirateten Marienthaler Mädchen und arbeiteten in der Fabrik. Der Ort bekam vom Fabriksherrn einen Kindergarten – und dieser noch mehr Frauen in seine Fabrik. Die älteren Kinder bekamen eine Schule, in der täglich unterrichtet wurde – zwei Stunden.
Nach 1890 erhielt die Fabrik einen neuen Direktor. Die Fabrik expandierte, die Produktion wurde auf den Export nach Ungarn und dem Balkan ausgerichtet – und die Klassengegensätze verschärften sich. Die Organisationen der Arbeiter wuchsen. Die Marienthaler Arbeiter schliefen nicht.
Im Weltkrieg erzeugten die Marienthaler Uniformen. Nach dem Umsturz erlangte der neugegründete Betriebstat starken Einfluß, die Reaktion der Unternehmer blieb nicht aus. Arbeitseinstellungen und gewerkschaftliche Kämpfe waren die Folgen.
Aber der Betrieb wuchs. Man produzierte nun Kunstseide, 1925 entstand ein weiterer Fabriksneubau mit einem Maschinenraum. Es war das Jahr des großen österreichischen Textilarbeiterstreiks. Die Marienthaler schlossen sich nicht aus. Und dann begann das langsame Sterben. Zwischen Juli und Dezember 1926 wurde die halbe Belegschaft entlassen. Dann schien es besser zu werden. 1927 und 1928 wurden neue Maschinen eingestellt, die Produktion sollte auf die Erzeugung breiterer Stoffbahnen umgestellt werden. Noch einmal wurden Arbeiter aufgenommen. »Aber das war eine rasch vorübergehende Besserung«, steht in der Studie. »Eine letzte Anstrengung der Mitte 1929der Absturz folgte: im Juli werden die Spinnereien geschlossen, im August die Druckerei, im September die Bleiche. Zuletzt im Februar 1930 sperrt die Weberei, und nun werden auch die Turbinen stillgelegt. Wenige Tage nachher beginnen unter großer Erregung der Bevölkerung die Liquidationsarbeiten. Etwa 60 Mann der Belegschaft werden zurückgehalten, ihnen fällt die Aufgabe zu, einen Teil der Fabrik niederzureißen. Ein Betriebsrat, der in diese Arbeitsgruppe eingeteilt wird, legt die Arbeit freiwillig nieder; er will nicht einer von denen gewesen sein, die die alte Arbeitsstätte zerstörten.«
Von den Fenstern ihrer Wohnungen sahen die Arbeiter auf die Trümmer ihrer Existenz.

Altes Arbeiterhaus in Marienthal
UND HEUTE?
»Aber heutzutage findet Gott sei Dank jeder Arbeit«, sagt ein alter Marienthaler. Aber die wenigsten in Marienthal und Gramatneusiedl. Was damals in Trümmer ging, wurde nicht wiederaufgebaut. Gewiß, es gibt eine kleine Strickerei, und auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik eine chemische Fabrik, die sogenanntes Paraglas herstellt. Doch nur wenig mehr als hundert Arbeiter finden Beschäftigung. »Und eine Konservenfabrik«, sagt ein Vierzehnjähriger aus Marienthal. »Ich arbeite dort seit einigen Monaten. Mit dem Chef sind wir acht Leute.«
In Moosbrunn existiert eine Glasfabrik, in Mitterndorf eine Weberei, die aber vor allem jugoslawische Gastarbeiter beschäftigt.
Die meisten der 2040 Einwohner von Marienthal und Gramatneusiedl arbeiten in Wien. Der sozialistische Bürgermeister von Gramatneusiedl Johann Wurschitz arbeitet beispielsweise in Wien-Simmering in der Zentralwerkstätte der Österreichischen Bundesbahnen. Sie fahren jeden Morgen nach Wien mit dem Auto, dem Motorrad, dem Autobus oder der Ostbahn – und jeden Abend wieder zurück. Manche der Jungen dort sind Jahre hindurch mit Freunden im Auto mitgefahren. Dann haben sie in Wien ein Untermietzimmer genommen. Sie kommen nur noch am Wochenende, zu den Feiertagen. »Und später bleiben sie ganz aus«, sagt ein alter Mann im verwilderten Park.
Ja, man trifft wenig junge Leute in Marienthal.
Marienthal stirbt. Die Jungen fliehen diesen Tod, und dadurch wird er nur noch früher kommen. Die Alten fürchten ihn, denn er ist ja auch ihr Tod. »Es liegt auch an den alten Wohnungen«, sagt Karl Petsch [recte Peč; Anm. R.M.]. Er ist 71 und einer von jenen, die noch in den Arbeiterhäusern aus der Gründerzeit wohnen. »Niemand von den Jungen will in diesen baufälligen Häusern wohnen.« Vor dem Haus, in dem Karl Petsch wohnt, hat man kürzlich über jedem Hauseingang ein Gerüst aufgestellt, damit niemandem ein Ziegel auf den Kopf fällt.
»Es geschieht an diesen Häusern ja nichts mehr«, sagt Karl Petsch [recte Peč; Anm. R.M.].
111 SCHILLING MIETE
Die Gemeinde Gramatneusiedl kann nichts dafür, daß die Häuser in Marienthal baufällig, die Zimmer feucht und klein und die Wohnungen teuer sind. Für Zimmer, Küche und Kabinett zahlt Karl Petsch [recte Peč; Anm. R.M.] 111 Schilling Miete. Es ist relativ so viel wie damals vor vierzig Jahren. Damals – die Leute hatten mit der Marienthal-Trumauer AG, der die Werkhäuser gehörten, einen kollektiven Mietvertrag abgeschlossen – zahlte der Arbeiter für Zimmer und Küche fünf Schilling im Monat. Arbeitslose vier Schilling. Die Zimmer und Vorraum kosteten drei beziehungsweise vier Schilling, Zimmer, Kabinett und Küche sechs. Die hießen damals »Großraumwohnungen«. Ein Kilogramm Kochmehl war damals 65 Groschen wert, ein Kilogramm Malzkaffee 96 Groschen.
FORTSETZUNG AUF SEITE V
»Grad zu Weihnachten bin ich damals entlassen worden; das war mein Weihnachtsgeschenk«, sagte der alte Mann nachdenklich und sinniert, ob das 1930 oder ein Jahr später gewesen ist. Karl Petsch [recte Peč; Anm. R.M.] lehnt sich an das Geländer des Werkskanals, der noch aus der Zeit der Fabriksgründung stammt. »Ich bin in Marienthal geboren«, sagt er. »Ein Jahrgang 1900 – wie der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, 1914, hab' ich in der Fabrik angefangen. Zuerst hab' ich Weberei gelernt, dann bin ich in die Schlichterei gekommen. Das ist die Vorbereitung der Weberei – dort hab' ich bis zum Stillstand geabeitet. Das war 1931 oder 1930. So genau weiß ich das nimmer.«
Der heuer Einundsiebzigjährige wohnt noch immer in Marienthal. In einem der ehemaligen »Arbeiterhäuser«.
*
Petsch [recte Peč; Anm. R.M.] war dann einige Jahre arbeitslos. »Eigentlich bis zum Anschluß. Dann haben wir ja Arbeit bekommen. Und dann war der Krieg.« Aus dem ist er noch 1945 heimgekommen. Im gleichen Jahr hat er auch seine Wohnung in einem der alten Häuser bekommen. »Dann hab' ich in der Glasfabrik in Moosbrunn gearbeitet.« Jetzt ist er in der Rente, steht an diesem, wie an jedem Sonntag vormittag am Werkskanal der ehemaligen Bleiche und erinnert sich.
»Das Herrenhaus von der Fabrik gibt es noch; da wohnen jetzt der Direktor und ein paar höhere Angestellte von der »Paraglas« drinnen.« Dahinter steht noch ein Ziegelbau der Marienthaler Fabrik. Irgendwo gibt es noch ein Lagerhaus, [!]
Die meisten alten Marienthaler stammen aus Marienthal. Die meisten begannen mit vierzehn Jahren in der Fabrik zu arbeiten, die meisten wurden in den dreißiger Jahren entlassen. Karl Petsch [recte Peč; Anm. R.M.] ist einer von ihnen.
W.K. [d.i. Walter Kratzer; Anm. R.M.]
Als kürzlich Paul F[elix] Lazarsfeld das Ehrendoktorat der Wiener Universität erhielt, fiel AZ-Redakteur Walter Kratzer die Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal« in die Hände, die Lazarsfeld gemeinsam mit Marie Jahoda und Hans Zeisel im Jahre 1931 erstellt hat. Er las mit Erschütterung über das Schicksal jenes winzigen Ortes, der damals, als einer von vielen in Österreich, dem Elend preisgegeben war. Walter Kratzer ist zu jung, um sich dieser Zeit selbst noch zu erinnern, er ist ein Kind der Nachkriegsprosperität. Vielleicht hat es ihn gerade deshalb gereizt, mit eigenen Augen zu sehen, was aus diesem Marienthal, dem Ortsteil von Gramatneusiedl, geworden ist, das seine Existenz einer Industrie verdankte und dessen Unglück mit dem Niedergang dieser Industrie begann. Er fuhr nach Marienthal und fand einen Ort, dessen Agonie nun schon vierzig Jahre dauert, wenn seine Bewohner sich auch aus Not und Elend der damaligen Zeit längst erholt haben.
V
Die Jungen gehen – Ältere resignieren
FORTSETZUNG VON SEITE 1
»Meine Wohnung ist relativ billig, weil ich schon seit 1945 darin wohne. Andere, die erst später eingezogen sind, zahlen bis zu 200 Schilling monatlich.« Die Häuser gehörten Privatleuten, erzählt er, die die ehemaligen Arbeiterhäuser »vom Hitler« als Entschädigung erhalten hätten für Grundstücke bei Sommerein in Niederösterreich. Dort haben sie 1938 einen Truppenübungsplatz angelegt. »Es ist verständlich, daß die an den Häusern nimmer viel machen. Von den Mieten können sie das ja nicht zahlen. Wenn sie diese Häuser wirklich renovieren würden, müßten wir das erst recht bezahlen. Aber geschehen müßt' schon was…« Gleichmut als Grundhaltung.
DIE RESIGNATION IST GEBLIEBEN
1931 schrieb das Kind eines Arbeiters aus der Umgebung Marienthals: »In den meisten Ländern Europas herrscht Not und Arbeitslosigkeit. In vielen reichen Familien werden das Brot und die Speisenreste weggeworfen, und manche Familie wäre bei uns dankbar, wenn sie das tägliche Brot hätte. Und so ist es in allen Ländern.« Und ein dreizehnjähriges Mädchen schrieb damals: »Ich möchte gern Schneiderin werden, aber ich fürchte mich, daß ich keinen Posten bekommen könnte oder daß ich nichts zu essen hab'.«

Da hatte sich Hermann Todesko ein Denkmal gesetzt. Das Denkmal ist längst verfallen wie ganz Marienthal. Zur Zeit der großen Wirtschaftskrise begann das Sterben des Ortes. Und es ist noch nicht zu Ende
Vor 40 Jahren stellten [Marie] Jahoda, [Paul Felix] Lazarsfeld und [Hans] Zeisel fest: »Sowohl bei den Kindern als auch bei den Jugendlichen ist der ihnen entsprechende Ausdruck der »resignierten« Haltung sehr deutlich. Da solche Haltung gerade dem, was wir an Kindheit und Jugend gewohnt sind, besonders widerspricht, liegt hier wohl der eine Grund, warum die Resignation … dem Außenstehenden als die Grundhaltung Marienthals erscheint.« Die Jungen von damals sind die Alten von heute. Die resignierende Grundhaltung haben sie behalten.
»Es scheint, daß gerade dann, wenn Marienthaler in größerer Zahl zusammen sind, der Wunsch und die Fähigkeit, zu vergessen, besonders deutlich werden«, steht in der Studie. Unter denen, die damals gerade geboren waren, ist es heute noch so. Die triste Umgebung versinkt vor der persönlichen Situation. »Uns geht's gut«, sagt eine etwa 45jährige Frau im einzigen Gasthaus von Marienthal. »Geld haben wir genug, zu essen haben wir genug, was geht uns ab?« Die ganz Jungen aber, die, die es damals noch gar nicht gab, sind anders, sie denken anders. »Was an Marienthal so trist ist, das sind die Verhältnisse«, sagt eine Neunzehnjährige. Der Kinobesuch am Sonntag, die Flucht mit Freund und Wagen woandershin, sind nur vorläufiger Ersatz. In ein paar Jahren will sie weg von ihren Eltern und Marienthal. Nach Wien. Dort arbeitet sie in einem Büro, dort wird sie leben. Die Jungen finden sich nicht ab, sie gehen.
FLUCHT IN DIE ERINNERUNG
Die alten Menschen flüchten auch – in die Erinnerung. »Vor 1929, mein Gott, da war Marienthal schön«, erzählt eine alte Frau. »In dem gepflegten Park hat es sogar einen Tennisplatz gegeben, da haben nur die Direktoren der Fabrik gespielt. Wir Mädel aber haben damals jeden Tag im »Herrenhaus« gefragt, ob die Herrschaften uns zum Ballholen brauchen…« Es ist eine von jenen, die vor 40 Jahren noch jung waren und auch damals vor den Interviewern der Studie schon von früher schwärmten: »Früher war es ja herrlich In Marienthal, schon die Fabrik war eine Zerstreuung. Im Sommer ist man spazierengegangen, und die vielen Unterhaltungen! Jetzt habe ich gar keine Lust, auszugehen.« Und ein Mann: »Das war ein Leben in Marienthal; jetzt ist alles tot im Vergleich.«
POLITISCHES INTERESSE
Für Politik hat man sich in Marienthal früher immer interessiert. Auch heute noch, doch hauptsächlich jene, die es noch von streitbaren Eltern lernten: die Vierzigjährigen.
In Marienthal und Gramatneusiedl ist man Sozialist. Bei den letzten Gemeinderatswahlen gab es knapp 1000 Stimmen für die Sozialisten, rund 300 Stimmen für die ÖVP, wenig mehr als 100 Stimmen für die Kommunisten. »In Moosbrunn hat es vor drei Jahren noch einen kommunistischen Vizebürgermeister gegeben«, erzählt ein junger Gendarm.
In Marienthal wohnen einige hundert jugoslawische Gastarbeiter, Arbeiter der Weberei in Mitterndorf [an der Fischa; Anm. R.M.]. Sie sind mit Familie hier und wohnen schlecht. Die Marienthaler, die eingesessenen, dulden sie, mehr nicht. Die älteren Marienthalerinnen kaum das: »Die haben uns noch gefehlt.« Einer der rund 20 in Gramatneusiedl ansässigen Bauern pflichtet bei: »Die sollen unter sich bleiben.« Die Marienthaler sind, wenn's um Gastarbeiter geht, wie andere Österreicher auch. Zu direkten Konflikten kommt es allerdings selten. »Es gibt nicht mehr Raufereien als anderswo in unserem Bezirk«, sagt die Gendarmerie.
Neben den politischen Parteien gibt es in Gramatneusiedl und Marienthal noch den Gewerkschaftsbund, eine ÖAAB-Ortsgruppe, den sogenannten »Sängerbund« und den 1908 gegründeten Fußballverein ASK Marienthal.
Im Marienthaler »Gasthaus Bürgermeister« sind Glücksspiel- und amerikanischer »Flipper«-Automat längst zu Hause. Die Männer spielen Karten, die Frauen erzählen einander von ihren Operationen. Ein alter Mann steht auf. »I fahr jetzt spazieren«, sagt er, »mit der Bahn nach Himberg, das kost nur 4 Schilling!«
ES IST KEIN TOD – UND AUCH KEIN LEBEN
»Uns geht es gut«, sagen die Leute in Marienthal. Und die es nicht meinen und nicht sagen, die gehen fort. Marienthal stirbt nicht, aber wenn man Leben an Expandieren mißt, an dem »Etwas-weiterBringen«, dann lebt es auch nicht. Aber vielleicht wird man in wenigen Jahren schon solche Orte suchen und beneiden, Orte, die bei der großen Wirtschaftskrise vor 40 Jahren von dem abgetrennt wurden, was man den Fortschritt nennt. Vielleicht werden die Jungen, die heute gehen, dann wiederkommen, weil dort noch reines Wasser aus den Brunnen zwischen alten Arbeiterhäusern plätschert und die Dorfstraße nicht asphaltiert ist, weil ohnehin kaum Autos fahren.