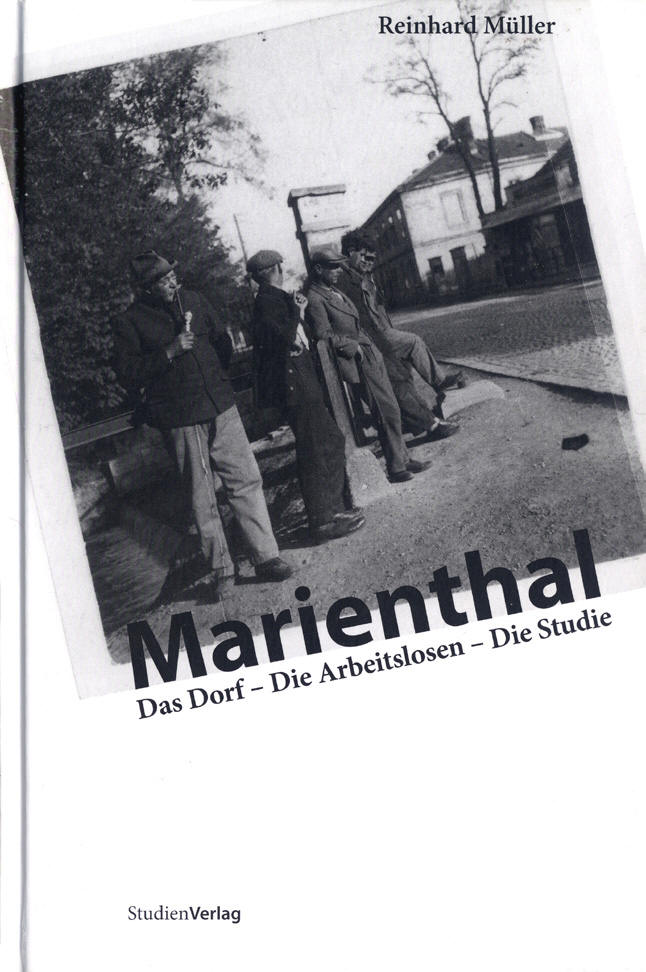
Marienthal. Das Dorf – Die Arbeitslosen – Die Studie
in: CSR / SOC News (Graz), 2. Jg., Nr. 5 (Februar 2009), S. [2].
Die Veröffentlichung auf dieser Website erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Reinhard Müller, Graz. Beachten Sie das Copyright!
[2]
Marienthal. Das Dorf – Die Arbeitslosen – Die Studie
»Die Arbeitslosen von Marienthal« (zuerst Leipzig 1933) ist längst ein Klassiker der empirischen Sozialforschung und eine international bekannte Gemeindestudie. Der Erfolg dieses Buches bewirkte in den Sozialwissenschaften eine weltweite Vertrautheit mit dem Namen »Marienthal«. Doch kaum jemand weiß mehr über diese Fabrik und Arbeiterkolonie als das Wenige, das in der Studie selbst mitgeteilt wird. So betrachtet, ist »Marienthal« ein Mythos geworden.
Im Buch wird der soziografische Querschnitt der Marienthal-Studie um einen historisch-soziografischen Längsschnitt ergänzt, der sich also nicht nur mit dem Marienthal der Arbeitslosen, sondern mit der langen und durchaus bemerkenswerten Entwicklung und den Traditionen dieser Fabrik und Arbeiterkolonie beschäftigt. Es werden das Gegen-, Neben- und seltene Miteinander von Bauerndorf Gramatneusiedl und Arbeiterkolonie Marienthal analysiert und die politischen wie kulturellen Besonderheiten dieser Arbeiterkolonie beschrieben, welche durchaus auf die Marienthal-Studie einwirkten, ohne allerdings deren generelle Thesen (etwa der müden Gemeinschaft oder die soziale Rolle von resignierten, verzweifelten und apathischen Arbeitslosen) einzuschränken.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es um die Geschichte der Fabrik und Arbeiterkolonie Marienthal im Umfeld jener des Bauerndorfs Gramatneusiedl. Es wird die frühe Entwicklung Gramatneusiedls von 1100 bis 1820 im Überblick geschildert, gefolgt von der Entstehung und Entwicklung der Textilfabrik Marienthal 1820 bis 1918, schließlich besonders ausführlich das Marienthal der Marienthal-Studie 1919 bis 1930. Es folgen die Arbeitslosenkolonie Marienthal 1930 bis 1938 und die Überwindung außerordentlicher Arbeitslosigkeit, Gramatneusiedl-Marienthal als Randsiedlung Wiens 1938 bis 1954, die schwierige Modernisierung des Orts 1954 bis 1995 und abschließend die Wiederentdeckung Marienthals in Marienthal (einschließlich der Verfilmung der Marienthal-Studie durch Karin Brandauer: »Einstweilen wird es Mittag…«). Besonderes Augenmerk wurde auf Entstehung und Entwicklung all jener Institutionen, Gebäude, Vereine und politischen Organisationen gelegt, die auch Gegenstand der Marienthal-Studie waren. Es werden aber auch die Besonderheiten herausgearbeitet, etwa die Prägung der Arbeiterkolonie durch die fast idealtypischen liberalen Fabrikbesitzerfamilien (von Todesco, Miller von Aichholz, Mautner) und, damit verbunden, das verhältnismäßig späte Erstarken der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Ungenauigkeiten bei den Erhebungen zur Marienthal-Studie kommen ebenso zur Sprache wie Fragen am Rande der Lektüre der »Arbeitslosen von Marienthal« (etwa »zum Treer gegangen«).
Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit der Marienthal-Studie selbst, jedoch nicht so sehr mit der ohnedies wissenschaftlich gut erschlossenen Frage der Methodik und ihrer historischen Verortung. Hier geht es vorrangig um das in der wissenschaftlichen Literatur zur Marienthal-Studie wenig oder gar nicht Beachtete. Es geht um die Genese und Durchführung der Studie, um die Auswertung der Materialien und Fragen zur Publikation, aber auch um die frühe Rezeption. Neben dem Projektträger, der Österreichischen Wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle, werden erstmals die Angehörigen des Projektteams genauer vorgestellt. Zum fünfzehnköpfigen Projektteam zählten neben dem Projektleiter Paul F. Lazarsfeld sowie den AutorInnen Marie Jahoda und Hans Zeisel auch später durchaus bekannt gewordene Persönlichkeiten wie die Wissenschaftlerinnen Lotte Schenk-Danzinger und Josefine Stroß oder aus dem Bereich der Politik Maria Deutsch, Karl Hartl und Walter Wodak.
Abgeschlossen wird das Buch mit Interviews, die Christian Fleck mit drei an der Marienthal-Studie zentral Beteiligten über ihre damaligen Erlebnisse und heutigen Einschätzungen führte: Marie Jahoda, Gertrude Wagner und Lotte Schenk-Danzinger.
Das Marienthal-Buch, das die Lektüre der Marienthal-Studie weder ersetzen will noch kann, ist als eine Ergänzung zu den »Arbeitslosen von Marienthal« gedacht, als ein Pool von Informationen, welche in den beiden ersten Teilen strukturiert und gebündelt dargeboten werden. Ein 45–seitiges Register ermöglicht aber auch dessen Nutzung als Nachschlagewerk. Das Buch richtet sich an sozialwissenschaftlich und historisch Interessierte, vor allem aber an Studierende, Lehrende und Forschende. Zu diesem Zweck werden auch 22 Dokumente abgedruckt, überwiegend Erstveröffentlichungen, vom Originalerhebungsbogen der ersten zuverlässigen Volkszählung Österreichs (Theresianische Seelenbeschreibung 1754) zu Gramatneusiedl, über Gemeinderatsdiskussionen anlässlich der Fabrikschließung und Arbeitsentwürfe zur Marienthal-Studie bis hin zum Projektentwurf für eine Nachfolgestudie (Erwerbslosensiedlung Leopoldau 1933). Umfangreiche Bibliografien zu Marienthal und zur Marienthal-Studie sowie 46 Abbildungen (darunter eine Gesamtansicht sowie ein Plan Marienthals) runden das Buch ab.
Hingewiesen sei auch – gleichsam als Ergänzung zum Buch – auf die umfangreiche, quellenorientierte Marienthal-Website http://agso.uni-graz.at/archive/marienthal/ und auf die Wanderausstellung »Rückblicke auf Marienthal« (siehe: http://agso.uni-graz.at/archive/marienthal/bilder/Tafel_Ausstellungsinformation.htm).
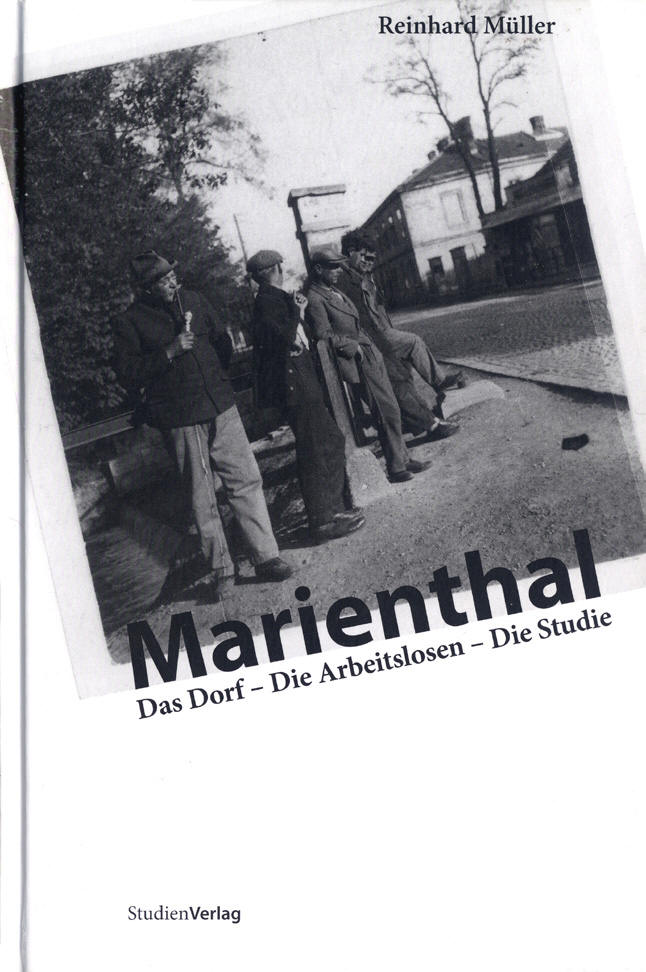
Reinhard Müller:
Marienthal
Das Dorf – Die Arbeitslosen – Die Studie.
Innsbruck / Wien / Bozen: StudienVerlag 2008