
Michael Freund & János Marton & Birgit Flos
Marienthal 1930–1980. Rückblick und sozialpsychologische Bestandaufnahme in einer ländlichen Industriegemeinde. Projekt Nr. 1521 des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank. Projektleiter: Prof. Dr. Alexander Giese.
Wien 1982, [II], 116 Bl.; Maschinenschrift.
Die Veröffentlichung auf dieser Website erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank, Wien, und von Michael Freund, Wien. Beachten Sie das Copyright!
[Titelblatt]
Marienthal 1930–1980
Rückblick und sozialpsychologische
Bestandaufnahme in einer
ländlichen Industriegemeinde
von
Michael Freund und János Marton (Sachbearbeiter)
und Birgit Flos
Projekt Nr. 1521 des Jubiläumsfonds
der Österreichischen Nationalbank
Projektleiter:
Prof. Dr. Alexander Giese
Wien 1982
1
Vorbemerkung
Die vorliegende Untersuchung wurde von uns gemeinsam geleitet. Dr. Martin Adel, Edith Haas, Dipl. Soz. Gerhild Ohrenberger und Elizabeth Sacre Ed.D. haben an Teilen der Studie mitgearbeitet. Die statistischen Analysen führte Robert Schächter, Exec Datenverarbeitung durch. Wir möchten an dieser Stelle dem Leiter des Projekts, Prof. Dr. Alexander Giese, für seine Unterstützung und umsichtige Hilfe und die Zeit, die er für uns aufgewendet hat, danken. Unser Dank gilt auch den Damen und Herren des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank für die Unterstützung beim Zustandekommen und der Abwicklung des Projekts. Er gilt schliesslich den Marienthalern und Gramatneusiedlern für ihre freundliche Teilnahme an unserer Arbeit. Die inhaltliche Verantwortung für den Bericht liegt bei uns.
B.F. M.F. J.M. [d.s. Birgit Flos, Michael Freund und János Marton; Anm. R.M.]
[I]
Inhalt
|
1. |
Einleitung |
2 |
|
|
|
|
|
2. |
Die Geschichte des Ortes |
4 |
|
2.1. |
Marienthal bis 1932 |
4 |
|
2.2. |
Die Studie |
6 |
|
2.3 |
Die Autoren |
10 |
|
2.4. |
Resonanz der Studie Marienthal |
13 |
|
2.5. |
Marienthal seit 1930 |
14 |
|
2.5.1. |
Der Ort |
14 |
|
2.5.2. |
Die Fabrik |
18 |
|
|
|
|
|
3. |
Methoden |
22 |
|
3.1. |
Probleme des Zugangs; erste Daten |
23 |
|
3.2. |
Der Fragebogen |
26 |
|
3.3. |
Oral History |
28 |
|
3.4. |
Die Stichprobe |
29 |
|
|
|
|
|
4. |
Resultate |
31 |
|
4.1. |
Soziale Distanz; Anomia |
31 |
|
4.2. |
Soziale Beziehungen; die Netzwerke |
34 |
|
4.3. |
Einstellung zu Gastarbeitern |
36 |
|
4.4. |
Gesundheitsfragen |
40 |
|
4.5. |
Arbeitslosigkeit |
46 |
|
4.6. |
Politik und Gewerkschaft |
50 |
|
4.6.1. |
Interessenvertretung durch Parteien |
50 |
|
4.6.2. |
Interessenvertretung durch Gewerkschaft |
53 |
|
4.7. |
Kirche |
54 |
|
4.8. |
Fallstudien |
55 |
|
57 |
||
|
4.8.2. |
Die Familie L. |
64 |
[II]
|
5. |
Exkurse |
69 |
|
5.1. |
»Der Jud'« |
69 |
|
5.2. |
Selbstverständigungstext |
73 |
|
5.3. |
Medienarbeit in Marienthal |
79 |
|
|
|
|
|
6. |
Schluss? |
95 |
|
|
|
|
|
7. |
Literatur |
98 |
|
|
|
|
|
8. |
Appendix |
102 |
|
|
|
|
|
|
Über die Mitarbeiter |
115 |
2
1. Einleitung
Ausgangspunkt unserer Untersuchung ist die 1933 erschienene Studie von Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel ›Die Arbeitslosen von Marienthal‹. In deren Vorwort heisst es:
»Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war, mit den Mitteln moderner Erhebungsmethoden ein Bild von der psychologischen Situation eines arbeitslosen Ortes zu geben. Es waren uns von Anfang an zwei Aufgaben wichtig. Die inhaltliche: zum Problem der Arbeitslosigkeit Material beizutragen – und die methodische: zu versuchen, einen sozialpsychologischen Tatbestand umfassend, objektiv darzustellen.«
Fünfzig Jahre später ist das Problem der Arbeitslosigkeit nicht mehr der zentrale Brennpunkt, sondern vielmehr ihre langfristigen, gesellschaftlichen Auswirkungen, die bisher in der Forschung kaum berücksichtigt worden sind. Die Arbeitslosigkeit der dreissiger Jahre bestimmte das wirtschaftliche Denken der Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau bewerkstelligte, und sie ist bis heute nicht nur in der Wirtschaftstheorie, sondern auch in politischen Programmen und im Denken und Handeln der Einzelnen wirksam.
Im Zusammenhang damit interessiert uns der sozialpsychologische ›Lebensraum‹ im heutigen Marienthal, die Arbeits- und Lebenszusammenhänge und der Grad der sozialen Integration, den die schwierige jüngste Geschichte hinterlassen hat.
Um zu einem umfassenden Porträt der Arbeitersiedlung zu gelangen, benützten wir systematisch strukturierte Fragebogen ebenso wie facettenhaft zustandegekommene Daten, Gespräche und Eindrücke. Entscheidend für unsere Arbeit
3
war der Versuch, Medien interaktiv einzusetzen. Parallel zu der sozialpsychologischen Untersuchung führten wir nämlich eine Videodokumentation Marienthals durch, und als Teilresultate beider Projekte entstanden Photoarbeiten und eine Radiosendung. Auf diese Weise profitierten die Projekte voneinander: Was in einem Videointerview zur Sprache kam, ging etwa in die Präzisierung des Fragebogens ein. Umgekehrt führten uns statistische Daten der Gemeinde zu Problemen, die wir filmerisch und photographisch behandeln konnten.
Wir setzten die Zusammenarbeit von Forschern und Erforschten voraus. Die durch Zwischenergebnisse entstandenen Rückmeldungsschleifen sollten Transparenz und Kontrolle der Marienthaler (Selbst-)Darstellung ermöglichen.
Obwohl es uns also nicht um eine Wiederholung der ursprünglichen Studie und einen Vergleich empirischer Daten ging, dient sie uns als gut bekannter Referenzpunkt und willkommene Ergänzung des historischen Teils. Sie ist darüberhinaus selber ein Stück österreichischer Sozial- und Wissenschaftsgeschichte geworden. Wir gehen daher im folgenden Kapitel auch auf die Studie und ihre Wirkung näher ein.
4
2. Zur Geschichte des Ortes
2.1. Marienthal bis 1932
»Wie andere Orte um einen Markt, eine Kirche oder eine Burg herum entstehen, so ist Marienthal um eine Fabrik herum entstanden. Die Geschichte dieser Fabrik ist zugleich die Geschichte des Ortes.«
Marienthal entstand um 1830, als der Wiener Bankier Hermann Todesko bei Gramatneusiedl, 24 km südöstlich von Wien im flachen und für Industrie geeigneten Wiener Becken eine Spinnerei gründete. Der Betrieb florierte bald. Eine Arbeitersiedlung entstand, die in vielem für die damaligen Verhältnisse aussergewöhnlich war. Die Wohnungen in den ca. 1880 gebauten langgestreckten einstöckigen Strassenhäusern waren klein, aber funktional und sauber. Es gab ein Kanalisationssystem und Frischwasserbrunnen. Diese Brunnen waren und blieben für Marienthal charakteristisch. Öffentliche Duschen und eine kleine Krankenstation vervollständigten den Eindruck einer vorbildlichen Siedlung. Die grossteils aus Böhmen und Mähren zugezogenen Arbeiter wohnten hier. Der Lohn war zwar sehr niedrig, aber der Mietzins auch, und wer einmal in Marienthal arbeitete, für den wurde von der Firmenleitung gesorgt.
Als der Spinnerei in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Weberei und Bleiche eingegliedert wurden, wuchs sie bald zum Grossbetrieb. In den neunziger Jahren fusionierte sie mit der Trumauer Seiden- und Baumwollweberei zur ›Trumau-Marienthal A.G.‹. An die Stelle des patriarchalisch geführten Familienbetriebs trat ein Management im modernen Sinn und auf Arbeitnehmerseite die gewerkschaftliche Organisation. Es begannen die Auseinandersetzungen um Löhne (der erste
5
Streik, 1890, wurde mit Militärhilfe niedergeschlagen). Schliesslich entwickelten sich eigenständige Arbeitervereine: die Kinderfreunde, der Turnverein, Freidenker, Radfahrerbund, Sterbeverein ›Die Flamme‹ – das Diktum, dass die Sozialistische Partei ›von der Wiege bis zum Grabe‹ sorgte, traf für Marienthal voll zu. Die Begeisterung für Fussball, um die Jahrhundertwende von englischen Webern importiert, führte 1905 zur Gründung des ›Arbeiterfussballklubs‹, der über die Region hinaus bekannt und erfolgreich wurde.
Ein Marienthaler Arbeiter zu sein, war etwas, worauf man stolz sein konnte, es bedeutete, seine Identität in einer tragenden aktiven Arbeiterbewegung zu finden und zu einer Gemeinde zu gehören, die sich selbstbewusst von dem eher ländlich-konservativen Gramatneusiedl abhob. Es kam zwar zu Spannungen zwischen den Alteingesessenen und den Zugewanderten und den verschiedenen Generationen von Einwanderern und Neuankömmlingen – den ›Ultrabemm‹, wie sie uns gegenüber apostrophiert wurden –, aber die wirklichen Spannungen spielten sich auf der Ebene der Klassengegensätze oder der verschiedenen politischen Einstellungen ab. Klare Klassenschranken zeigten sich beispielsweise in dem von der Firma angelegten Park, dem ›Herrengarten‹, in dem nur die Firmenleitung Tennis spielen und die Angestellten Kegeln durften. Nur die Parkwege waren für alle da.
Das ›rote Wien‹ als kultureller und politischer Bezugspunkt war nah, entzog Marienthal aber nicht seine kommunale Eigenständigkeit. Die bildungsbewussten Arbeiter fuhren wohl zu Kulturveranstaltungen oder Parteitreffen in die Hauptstadt, hatten aber ihre feste sozio-kulturelle Identität in der Siedlung Marienthal.
6
Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu verstärkten gewerkschaftlichen Kämpfen und zu zyklischen Krisen in der Textilindustrie. Eine Expansion um 1929 war ebenso vorübergehend, wie die besonders gute Auftragslage in dieser Zeit. Der Absturz der Firma, hervorgerufen durch die Weltwirtschaftskrise, verstärkt durch die schwierige Situation der österreichischen Textilindustrie auf dem Exportmarkt, kam sehr plötzlich: Zwischen Juli 1929 und Februar 1930 wurde nach und nach die ganze Fabrik stillgelegt, von den 478 Familien Marienthals hatten 367 keine Einkommensquelle.
Die darauffolgenden Jahre waren wie in vielen benachbarten Industriegemeinden von Elend und Stagnation gekennzeichnet. Der Zufall wollte es, dass über die Situation in Marienthal mehr und genaueres bekannt wurde.
2.2. Die Studie
Am psychologischen Institut der Universität wurde 1927 vom Assistenten Paul F. Lazarsfeld eine ›Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle‹ ins Leben gerufen, der Prototyp eines der Universität angeschlossenen, aber unabhängig geführten Instituts, das auch von Aussenstellen Forschungsaufträge annehmen konnte. Gründer und Mitarbeiter waren Sozialwissenschaftler, die der Sozialistischen Partei zumindest nahestanden und von der Notwendigkeit einer empirisch zweckrational betriebenen Sozialforschung überzeugt waren, die sich in einem politisch bewussten Rahmen mit grundlegenden gesellschaftspolitischen Fragen befassen sollten. Lazarsfeld drückte das damals in der Formel aus, dass die heraufziehende Revolution vor allem Nationalökonomen brauche (ein Hinweis auf die sozialistische Vorkriegsliteratur), dass die siegreiche
7
Revolution sich auf Ingenieure stütze (eine Anspielung auf Russland) und »dass die verlorene Revolution aus uns Sozialpsychologen gemacht hatte« (vgl. Lazarsfeld, in Fleming & Bailyn, 1969, S. 272). Psychologie meinte dabei nicht so sehr die Psychoanalyse Freuds, obwohl die Mitarbeiter der Forschungsstelle auch ihr ein gewisses Interesse entgegenbrachten, als vielmehr die ›rationalere‹ Psychologie Adlers bzw. die Kinder- und Sozialpsychologie am Psychologischen Institut der Bühlers [d.s. Charlotte Bühler und Karl Bühler; Anm. R.M.], die nach strikten statistischen Gesetzmässigkeiten forschten. »Unter Sozialpsychologie verstanden wir das quantitative Studium von Massenerscheinungen.« (Lazarsfeld im neuen Vorwort zur Studie, 1975, S. 13).
Die Forschungsstelle bekam allerdings mehr Aufträge von der Industrie als von der Partei. Die ersten, inzwischen sprichwörtlich gewordenen Meinungsumfragen über Seifenkauf stammten aus dieser Zeit, aber auch die ersten Wahlanalysen und der österreichische Teil der grossen empirischen Arbeit über Autorität und Familie am Frankfurter Institut für Sozialforschung unter Max Horkheimer.
Wie es 1930 zu der Idee einer Untersuchung über Arbeitslosigkeit kam, wurde von den Beteiligten übereinstimmend belegt (vgl. Fleming und Bailyn, 1969, S. 275; Zeisel, 1980, S. 43; Jahoda in Greffrath, 1979, S. 122): ursprünglich wollten die Mitarbeiter eine Studie über das Freizeitverhalten der Arbeiter machen. Als der sozialistische Parteiführer Otto Bauer das hörte, reagierte er zornig und fragte sie, warum sie nicht stattdessen die bedrohlichen Auswirkungen andauernder Erwerbslosigkeit, also erzwungener freier Zeit, erforschen wollten. Er konnte auch einen Ort nennen, der besonders betroffen war und den er aus eigenen Besuchen kannte: eben jenes Marienthal mit seiner stillgelegten Fabrik.
8
Was darauf folgte, ist ein Stück Sozialforschungsgeschichte geworden, nachzulesen am besten in den knapp neunzig Seiten des Berichtes selbst: ›Die Arbeitslosen von Marienthal, ein soziographischer Versuch‹, erschienen 1933 (wir zitieren nach der Taschenbuchausgabe 1975). Lazarsfeld leitete die Untersuchung als Institutsdirektor. Marie Jahoda, damals vierundzwanzig, leitete die Arbeit vor Ort vom Herbst 1931 bis Mai 1932 und verfasste danach im wesentlichen den Bericht. Hans Zeisel schrieb den Anhang zur ›Geschichte der Soziographie‹.
Ziel war es, eine ›Geschichte der Gegenwart‹ mit sozialwissenschaftlichen Methoden zu schreiben, wobei eine ganze Gemeinde und nicht nur die einzelnen Bewohner Untersuchungsobjekt waren. Die Autoren trugen mit ungewöhnlichen Methoden Material zum Thema zusammen und verarbeiteten es zu einem dichten sozialwissenschaftlichen Bericht. Die Kapitelüberschriften veranschaulichen die wesentlichen Studien der Untersuchung: Nach einem Abriss über Geschichte und Gegenwart Marienthals (›Das Industriedorf‹) und detaillierten Beobachtungen über den Alltag: die Arbeitslosenunterstützung, das Wochenbudget, den schlechter werdenden Gesundheitszustand der Bevölkerung (›Der Standard‹) kommt es zu verallgemeinernden Thesen über die Wirkungen des sozialen Traumas. ›Die müde Gemeinschaft‹ beschreibt den Rückgang politischer und sozialer Aktivität seit dem Zusammenbruch, Auflösungserscheinungen in den Vereinen, Zunahme anonymer Anzeigen wegen Schwarzarbeit usw. ›Die Haltung‹ bezieht sich auf vier Arten, mit dem Zustand fertigzuwerden: die ungebrochene Haltung, die resignierte, die verzweifelte und die apathische Haltung. Ein ganzes Kapitel wird dem Zeitempfinden gewidmet – ein ungewöhnliches Beobachtungsobjekt, gemessen mit neuartigen Methoden, die später als ›unobtrusive measures‹ oder ›nichtbeeinflussende Messverfahren‹ in die Forschungspraxis
9
eingingen. ›Die Widerstandskraft‹ schliesslich beschäftigt sich mit der Frage, wann bei steigender Not »sich die Schicksalsverbundenheit der Marienthaler Bevölkerung … löst und jeder sich seinem eigenen Rettungsversuch anvertraut…« (Jahoda et al., 1975, S. 103).
Ein Ergebnis der Untersuchung war auch, dass die Arbeiterschaft auf Massenarbeitslosigkeit mit Resignation und Apathie reagiert und dass die angenommene (oder auch befürchtete) revolutionierende Wirkung ausblieb.
»Wir haben als Wissenschaftler den Boden Marienthals betreten«, beenden die Autoren ihren Bericht. »Wir haben ihn verlassen mit dem einen Wunsch, dass die tragische Chance solchen Experiments bald von unserer Zeit genommen werde.« (ibid.; S. 112). Sie konnten nicht voraussehen, dass es noch schlimmer kommen würde.
Die Studie erschien zwei Monate nach Hitlers Machtergreifung bei Hirzel in Leipzig, wurde kurz darauf verboten und wieder eingestampft oder verbrannt. So war es vermutlich auch nicht die Studie selbst, sondern Lazarsfelds Vortrag in Hamburg, der englische Quäker dazu veranlasste, 1934 freiwillige Helfer nach Marienthal zu schicken, um eine Landwirtschaftskooperative aufbauen zu helfen. Diese einzige unmittelbare Konsequenz der Untersuchung für die Gemeinde scheiterte aber schon nach einer Saison, der eigentliche Sinn der Quäker-Aktion blieb der Bevölkerung weitgehend uneinsichtig. Manche alte Marienthaler erinnern sich ›an Engländer, die da herumgegraben haben‹.
Das Buch wurde erst wieder 1960 im Verlag für Demoskopie, Allensbach, verlegt, mit einem ›Vorspruch zur neuen Auflage‹ von Lazarsfeld. Auf dieser Ausgabe beruht die Suhrkamp-Taschenbuch-Edition von 1975. Englisch erschien
10
›The sociography of an unemployed community‹ 1971 bei Aldine, Chicago. Das Buch ist inzwischen in alle wichtigen Sprachen übersetzt.
Dass eine Episode aus der Geschichte einer kleinen niederösterreichischen Arbeitersiedlung so viel Beachtung fand, hat sicher mit der innovativen Methodik der Arbeit zu tun, aber auch mit dem weiteren beruflichen Werdegang der Autoren.
2.3 Die Autoren
Schon 1932 schickte Charlotte Bühler vom Psychologischen Institut ihren Assistenten Lazarsfeld zum internationalen Psychologenkongress nach Hamburg, um über den Fortschritt der Arbeit in Marienthal zu berichten (vgl. Hauer, 1981, S. 21; Neurath, 1980, S. 8). Es ist nicht ganz geklärt, ob es sein dortiges Referat war, dass die Aufmerksamkeit amerikanischer Psychologen wie Gordon Allport und Goodwin Watson erweckte (vgl. Lazardsfelds eigene Darstellung in Fleming und Bailyn, 1969, S. 293) oder seine frühere Marktforschung, von der die Rockefeller-Stiftung gehört hatte (vgl. Pollack, 1980, S. 8; die Stiftung war auch zusammen mit der Wiener Arbeiterkammer an der Finanzierung der Marienthaler Studie beteiligt): jedenfalls erhielt Lazarsfeld im Herbst 1932 ein Rockefeller-Stipendium für Amerika, das er im September 1933 antrat.
Nach dem Ablauf des Stipendiums beschloss er, in Amerika zu bleiben. Er bekam einen Lehrstuhl an der Columbia Universität in New York und arbeitete hauptsächlich auf den Gebieten der Methodologie sowie der Wahl- und Entscheidungsforschung. Nach seiner Emeritierung unterrichtete er bis zu seinem Tod 1976 an der Universität von Pittsburgh.
11
Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Biographien und Festschriften gewürdigt (vgl. z.B. Merton et al., 1979), wobei häufig auf die Kontinuität seiner Vorstellung von relevanter Forschung seit den Tagen der Wiener wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle hingewiesen wird. Zeisel spricht von ihr als der »Grossmutter aller späteren Sozialforschungsinstitute in der Welt« (1980, S. 43). Lazarsfeld hatte diese Idee sozusagen nach Amerika exportiert. Die Gründung des renommierten Bureau of Applied Social Research an der Columbia Universität führte er auf sein Wiener Modell zurück (vgl. Fleming and Bailyn, 1969, S. 274ff, S. 285–296).
Kritische Auseinandersetzungen mit Lazarsfeld (siehe dazu vor allem das Material in Pollack, 1980) verweisen auf seinen Weg vom austro-marxistischen Aktivisten zum »multinationalen Organisator empiristischer Forschung« (ibid., S. 1). Er selbst hat von der »Äquivalenz vom Wahlverhalten und Seifenverkauf« gesprochen. Pollack vermutet darin einen frühen Verzicht auf inhaltliche Relevanz und ein beiden momentan immanentes Kontrollinteresse, das mit der Lassalle'schen Vorstellung eines Sozialismus von oben übereinstimmt (ibid., S. 7). Ausserdem sei methodologischer Formalismus »der beste Weg für einen Fremden, einen soziologischen Diskurs über eine Gesellschaft zu entwickeln, mit der er nicht vertraut ist.« (ibid., S. 22).
Seine methoden- und absatzorientierte Forschung kollidierte auch mit Adornos Vorstellung von Inhalt und Wahrheit des Denkens. Die kurze Zusammenarbeit der beiden an dem Radio Research Project in New Jersey 1938/40, die sie sehr unterschiedlich, aber mit gegenseitigem Respekt interpretierten (vgl. Fleming und Bailyn, 1969, S. 300, 322–325; Adorno, 1968, S. 116–131), nahm in der Praxis den sogenannten Positivismusstreit in der deutschen Soziologie vorweg.
12
In direkterer Weise ist Marie Jahodas politische und berufliche Laufbahn auch später noch mit den Intentionen der Studie verbunden. Sie übernahm 1933 nach Lazarsfelds Abgang die Leitung der Forschungsstelle in Wien. 1935 wurde sie als revolutionäre Sozialistin inhaftiert. 1936 emigrierte sie nach England und arbeitete unter anderem wieder an einer Studie über die Auswirkung von Arbeitslosigkeit (vgl. Jahoda, 1936). In dieser unveröffentlichten Studie über Arbeitslosigkeit unter Bergleuten in Wales, einem ›Subsistenz-Produktionsexperiment‹, bezieht sie sich direkt auf ihre Erfahrungen in Marienthal.
Später in den USA und seit den fünfziger Jahren wieder in England – sie unterrichtet noch immer als emeritierte Professorin an der Universität von Sussex – beschäftigte sie sich insbesondere mit den Forschungsschwerpunkten ›Psychische Gesundheit‹ (sie war massgeblich an Untersuchungen des National Institute of Medical Health beteiligt), Vorurteile und Einstellungen. Wichtige Themen ihrer Forschungstätigkeit blieben aber weiterhin Arbeit und Arbeitslosigkeit (siehe Jahoda, 1981).
Im Sommer 1980 besuchte sie mit uns Marienthal, zum ersten Mal seit fast fünfzig Jahren. In langen Gesprächen mit den Dorfbewohnern, die sich zum Teil noch an das Forschungsteam erinnern konnten, gab sie ihrer Freude über die beobachteten Veränderungen im Erscheinungsbild des Ortes Ausdruck. Sie war besonders interessiert an der Frage, was an die Stelle der einigenden und aktivierenden Rolle der Sozialistischen Partei getreten sei, die ja den Einfluss als politische und kulturelle Kraft nicht mehr zurückgewinnen konnte, den sie vor dem Zusammenbruch und vor ihrem eigenen Niedergang 1934 gehabt hatte. Diese entscheidende Fragestellung half uns, das Problem der soziopsychologischen Integration in Marienthal genauer zu formulieren.
13
Auch Hans Zeisel emigrierte 1938 nach Amerika, wo er zunächst weiter an methodologischen Fragen der Soziologie arbeitete. Später war er bis zu seiner Emeritierung Professor für Rechtssoziologie an der Universität von Chicago.
2.4. Resonanz der Studie Marienthal
Die Untersuchung blieb ohne Konsequenzen für den Ort selbst. Die Erinnerungen an das Team, an Kinderärztin, Winteraktion und an ›die Engländer‹ verblassten bald. Nach der Befreiung 1945 hatten die Marienthaler anderes zu tun, als sich einer Initiative von vor fast fünfzehn Jahren zu entsinnen, zu offensichtlich war vielleicht der nur punktuelle Charakter, der mit einer solchen soziographischen Studie verbunden ist. Die Neuauflage des Buches 1960 erreichte Marienthal kaum. Das eine Exemplar in der Gramatneusiedler Gemeindebücherei war bald unauffindbar. Die grosse Mehrheit der Marienthaler kennt die Studie nur vom Hörensagen oder garnicht. Durch unsere Arbeit konnten wir das Interesse an der Untersuchung wieder wecken. Circa fünfzig Exemplare der Taschenbuchausgabe wurden in der Trafik in Marienthal verkauft. Die Reaktionen der Leser, mit denen wir sprachen, reichten von der Bemerkung, dass das Buch zu trocken sei, ›zuviele Zahlen‹, bis zur Freude an der detaillierten Darstellung und zu Versuchen, möglichst viele in den Protokollen verschlüsselte Namen zu erkennen oder zu rekonstruieren.
14
2.5. Marienthal seit 1930
2.5.1. Der Ort
An Marienthal lässt sich exemplarisch die Geschichte eines Industriedorfes nachzeichnen, das durch die Weltwirtschaftskrise langfristig seine Basis verlor und sich mühsam auf neue Lebens- und Arbeitsformen umstellen musste. Dieser Prozess hält bis zum heutigen Tage an. Dass er weitgehend aussenbestimmt ist und den grösseren wirtschaftlichen Entscheidungen unterworfen, charakterisiert die Abhängigkeit Marienthals heute ebenso wie die Entwicklung, die 1930 zur Stillegung der Fabrik führte.
Der Februaraufstand 1934 bedeutete den letzten gescheiterten Versuch der sozialdemokratischen Kräfte, sich gegen den bürgerlichen und reaktionären Block zu wehren. Die Sozialisten in Marienthal fühlten sich von den führenden Kräften in der Partei im Stich gelassen. Einige wären, so berichten sie heute, trotz aller Entmutigungen zum Kampf bereit gewesen, aber es fehlte jegliche Koordinierung. »Die Waffen des Schutzbundes waren versteckt, aber niemand hat gewusst wo«, erinnert sich eine Genossin, die in diesen Jahren aus Enttäuschung zur Kommunistischen Partei übergetreten war.
Die Spannungen zwischen Marienthal und Gramatneusiedl wuchsen seit 1934 eher noch. Statt einer selbstbewussten Arbeiterschaft sahen sich die Bauern nun einer resignierten und wirtschaftlich kaum noch überlebenden Siedlung gegenüber.
Viele, »die tüchtigeren«, wie oft betont wird, suchten sich woanders Arbeit oder wanderten überhaupt aus, nach Deutschland, Frankreich, Rumänien, sogar bis Ägypten –
15
wo immer Spinnerei- und Weberei-Facharbeiter gebraucht wurden. Viele pendelten jetzt bis nach Wien. Zurück blieben die Alten, die Kinder, diejenigen, die keine Arbeit mehr finden konnten oder wollten. 1938 war ein Viertel der Arbeitsbevölkerung noch immer arbeitslos.
Wir trafen auf kaum einen alten Marienthaler, der mit [Adolf] Hitler sympathisieren würde, aber auf viele, die den »Anschluss‹ im März 1938 als Befreiung empfanden: Es gab endlich wieder Arbeit und Essen aus den ›Gulaschkanonen‹: Man konnte sich allerdings »ausrechnen, dass das nicht ewig so weitergeht. Von nix kommt nix«, rechnete uns eine Geschäftsfrau vor. Nach einigen Wochen wurde das Essprogramm eingestellt.
Während der Zeit der Nazi-Herrschaft gab es politischen Opportunismus, Parteiwechsel und ein Sich-Arrangieren ähnlich wie anderswo in Österreich auch. Aussergewöhnlicher sind die Fälle aktiven politischen Widerstands, die zu Gestapo-Verhaftungen und zur Hinrichtung von fünf Männern und Frauen führte. Dass ihre Namen im Gramatneusiedler Gedenkstein als Kriegsopfer geführt werden, zählt zu den merkwürdigen Umdeutungen, die die Nazizeit nach dem Krieg erfahren hat.
Der Ort wurde bis in die letzten Monate vom unmittelbaren Kriegsgeschehen verschont, erst als sich die SS zurückziehen musste, sprengte sie die Brücke über die Fischa und schoss die grosse Lagerhalle in Brand. Als hätte es dieses Fanals noch bedurft, gloste der Brand über ein Jahr lang weiter.
Wenn wir Marienthaler nach Kriegserinnerungen fragten, stand der Einmarsch der russischen Soldaten im März 1945 weit eher im Zentrum der Erzählungen als die sechs Jahre vorher. Die ersten Wochen der ›Befreiung‹ blieben als eigentliches Kriegstrauma in der Erinnerung der Marienthaler.
16
Arbeitslosigkeit, Krieg, Nachkriegselend, nur zögernder Wiederaufbau – für viele Marienthaler summierten sich die schlechten Zeiten auf über zwanzig Jahre. Die meisten gewöhnten sich daran zu pendeln, mit den bevorzugten Zielen Wien und Schwechat. Für einige kam der Nachkriegsboom zu spät. In Marienthal bildete sich eine Randschicht heraus, die in den schlechtesten Quartieren im Ort wohnt, sozusagen ein Slum im Slum.
Denn dazu sind inzwischen auch die Siedlungshäuser geworden. Was einmal als fortschrittlich und beispielhaft galt, verlor zunehmend an Wohnwert. Schon kurz nach dem Zusammenbruch der Firma hörten die meisten von der Firma gebauten Einrichtungen auf zu funktionieren, die Krankenstation ebenso wie die Kanalisation. Auch der Herrenpark, in der Erinnerung vieler der sichtbare Beweis für die wirtschaftliche Blütezeit Marienthals, verwilderte. Die Alleen waren nach einigen Jahren kaum noch auszumachen. Der neue Besitzer liess die alten Bäume in der Kriegszeit gewinnbringend fällen, aus dem Eschenholz wurden Gewehrkolben. Die Bauern, die die Wohnhäuser als Entschädigung für kriegsrequiriertes Ackerland bekommen hatten, kümmerten sich nicht um die Instandhaltung. Es wurde nichts repariert, noch nicht einmal die Toilettenkanalisation, so dass die Bewohner der alten Strassenhäuser noch heute Plumpsklos ausserhalb der Wohnhäuser benutzen, die sie zudem mit mehreren Hausparteinen teilen.
Die Siedlung ist andererseits als Industriedenkmal architekturhistorisch interessant. So sicherte Wissenschaftsministerin Firnberg bei einem Besuch im Frühjahr 1979 der Gemeinde Gramatneusiedl Unterstützung bei weitreichenden Sanierungsplänen zu. Die Gemeinde kaufte die meisten Siedlungshäuser auf und begann 1981 mit einer kostspieligen Revitalisierung.
17
Im einzelnen bedeutet das: Zusammenlegung einzelner 25 m2-Wohnungen zu grösseren Einheiten – was einige Bewohner schon selbst durchgeführt haben; moderne Bad-, Koch- und Heizmöglichkeiten; schliesslich auch Abriss der Schuppen und Plumpsklos und möglicherweise Errichten von Parkplätzen. Die Bewohner, die nach den Plänen der Gemeinde nicht hinausgedrängt werden sollen (saniert wird, wenn genügend Wohnungen ›freiwerden‹), beobachten die Revitalisierung mit gemischten Gefühlen. Einig sind sich die meisten darüber, dass etwas geschehen musste, und auch mit den möglichen Grundrissen sind sie einverstanden, soweit sie von ihnen Kenntnis haben. Weniger erfreut sind diejenigen, die bleiben wollen, über die um ein Vielfaches gestiegenen Mieten. Eine weitere Klage, die wir hörten, bezog sich auf den Zwang, an das Wassernetz angeschlossen zu werden. »Es ist teuer und schlechter als unser Brunnenwasser«, wenn es auch dafür ins Haus kommt.
Um den Kern – das Gebiet aus der Zeit der Studie – haben sich seit den fünfziger Jahren im wesentlichen zwei neue Strukturen gelegt:
Zum einen sind es drei- bis vierstöckige Gemeindebauten, die, auf eine Wiese zwischen Marienthal und dem ›eigentlichen‹ Gramatneusiedl gebaut, die beiden Teile der Gemeinde nun auch physisch miteinander verbinden. Wer es sich leisten konnte oder Beziehungen hatte, zog aus der Einheitswohnung der alten Siedlung in die Gemeindewohnungen.
Zum anderen bauten sich Marienthaler, Gramatneusiedler, zum Teil auch Wiener, Eigenheime auf die parzellierten Auen um Marienthal. Es entstanden ganze Siedlungen, und noch ist kein Ende abzusehen. Während unseres Aufenthalts entstand quasi vor unseren Augen ein neuer Ortsteil auf einer Wiese direkt hinter den Schuppen der Altbauten.
18
In welcher Weise sich die sozialen Beziehungen zwischen Kernbewohnern und Eigenheimbesitzern entwickeln werden, ist noch ungewiss. Die – landesübliche – ›Zersiedelung‹ im alpinen Walmdachstil bedeutet jedenfalls einen weiteren Schritt weg von der ehemaligen festgefügten Industriegemeinde.
2.5.2. Die Fabrik
Auch die Geschichte der Fabrik steht beispielhaft für die Veränderungen, die viele Industrieorte gerade im Wiener Becken durchgemacht haben. Ein Stück jüngster österreichischer Wirtschaftsgeschichte lässt sich anhand der wechselnden Nutzung des Industriegeländes illustrieren.
»(Wenige Tage nach der Stilllegung der Turbinen) begannen unter grosser Erregung der Bevölkerung die Liquidationsarbeiten« (Jahoda et al., 1975, S. 35).
Genauer: Was keinen Produktionswert hatte, wurde verkauft, so etwa die Wohnhäuser und der Park. Ein Teil der Fabrik wurde niedergerissen. Nach übereinstimmenden Aussagen einiger alter Marienthaler, die mit nach Rumänien ausgewanderten Arbeitskollegen Kontakt hatten, liessen die Liquidatoren einen Teil der Maschinen, darunter mehrere Webstühle, nach Rumänien zu einer billigen Produktionsstätte abtransportieren. Diese neue Fabrik soll sogar zur selben Firmengruppe gehört haben, wie die ehemalige Trumau-Marienthal A.G. Der Bankrott hätte dann lediglich eine Verlagerung der Produktion in ein ›peripheres‹, billigeres Land beschleunigt. Das Firmengelände an der Fischa jedenfalls lag brach.
19
»Von ihren Fenstern sehen die Arbeiter auf ihrer früheren Arbeitsstätte Schuttfelder, verbeulte Kessel, alte Transmissionsräder und halbverfallenes Mauerwerk.« (ibid., S. 35)
1933 interessierte sich der Unternehmer Sonnenschein für das Gelände. Er kaufte es relativ billig und führte den Betrieb mit einhundertdreissig Leuten und neuen Maschinen als kleine Weberei weiter. Manche der entlassenen Facharbeiter aus Marienthal bekamen bei ihm wieder Arbeit.
1938 wurde Sonnenschein enteignet, der Betrieb ›arisiert‹. Über die nächsten Jahre erfuhren wir nur, dass die deutsche Verwaltung die Produktion verringerte und schliesslich einstellte. 1945 kam es zur schon erwähnten Zerstörung des Lagerhauses.
Trotz allem gab es nach dem Krieg noch einige Webstühle, Färbkessel u.ä. Der Sohn »des alten Sonnenschein« führte die Firma ohne grosses Interesse von London aus weiter und kam einmal im Jahr zur Inspektion.
In den fünfziger Jahren zeichneten sich ernste Absatzschwierigkeiten ab, Sonnenschein verkaufte schliesslich.
Im Herbst 1958 begann die letzte Episode der Textilgeschichte Marienthals. Sie war von Fehlinvestitionen und Verkaufsschwierigkeiten gekennzeichnet. Karoly [recte Justinian Karolyi; Anm. R.M.], der die Firma von Sonnenschein erworben hatte, wollte auf dem EFTA-Markt mit Grossbritannien ins Geschäft kommen, aber es war zu spät. In der Branche zeichnete sich bereits die ausländische, auch die fernöstliche Konkurrenz ab.
1960 standen auch aufgrund glückloser Geschäftsführung die Anlagen wieder still.
20
Im Jahr darauf kauften die Österreichischen Chemischen Werke, eine hundertprozentige Tochter des Westdeutschen Unternehmens Degussa, das Firmenareal. Ihre Zweigfirma Para-Chemie stellt dort seit 1962 Acrylglas her. Marienthal schien den Österreichischen Chemischen Werken ein günstiger Standort, weil man ein Reservoir an Arbeitskräften erhoffte. Es stellte sich jedoch heraus, dass sich nur wenige Pendler entschlossen, wieder im Ort selbst zu arbeiten, auch als der Betrieb begann, die Löhne dem Wiener Niveau anzugleichen. Etwa die Hälfte der Arbeiter sind heute Gastarbeiter aus Jugoslawien. Zweihundert Beschäftigte produzieren Acrylglas in einem patentierten Wasserbadverfahren. Von den österreichischen Arbeitern kommt über die Hälfte aus den umliegenden Dörfern, nur knapp dreissig Beschäftigte sind Bewohner Marienthals.
Der neue Betrieb hat wieder Geld in Form von Steuern und gesteigertem Konsum im Ort nach Marienthal gebracht. Einige Läden und zwei Gasthäuser machen wieder ein besseres Geschäft, seit es die Firma im Ort gibt. Das eine Lebensmittelgeschäft allerdings, der Konsum, kann seit kurzem nicht mehr bei den umliegenden Produzenten selbst einkaufen. Die gesamte Distribution wird in Wien entschieden und im neuen Wiener Zentrallager durchgeführt. Das andere Kaufhaus, der in der alten Studie öfter erwähnte Treer, wurde während unseres Aufenthaltes vom zweiten Lebensmittelgiganten, Julius Meinl, übernommen. Zum Grosseinkauf fahren Marienthaler auch oft in die 28 km entfernte Shopping City Süd. Die Werkstatt und das Ersatzteillager neben dem Fabriksgelände gehören den deutschen VAG bzw. Bosch-Konzernen. Zieht man noch dazu in Betracht, dass alle Entscheidungen bezüglich der Para-Chemie letztendlich von der Mutterfirma in der BRD getroffen werden, so lässt sich ermessen, in welcher ökonomischer Abhängigkeit sich Marienthal befindet.
21
Wie viele andere periphere Orte ist die Gemeinde heute in verstärktem Mass ›aussengelenkt‹, und es wundert uns nicht, dass nach den bisherigen Erfahrungen die Marienthaler gegenüber politischen und wirtschaftlichen Versprechungen jeder Art eher skeptisch sind. Ein aktueller Grund zur Skepsis stellte sich kurz nach Beendigung unserer Untersuchung ein: In der Folge einer Krise auf dem Kunststoffmarkt wurden einige Arbeiter der Para-Chemie entlassen.
22
3. Methoden
Paul Lazarsfeld stellte für die ursprüngliche Marienthalstudie vier Regeln auf, nach denen das Forscherteam 1932 seine Erhebungen strukturierte:
|
a) |
Für jedes Phänomen sollte man sowohl objektive Beobachtungen als auch introspektive Eindrücke und Berichte haben. |
|
b) |
Fallstudien sollten mit statistischen Daten kombiniert sein. |
|
c) |
Zeitgenössische Information sollte durch Informationen über frühere Erscheinungsformen des untersuchten Problems ergänzt werden. |
|
d) |
Die sogenannten ›natürlichen Daten‹ sollten mit experimentellen Daten kombiniert werden. |
Bei diesen Überlegungen ist das Bestreben im Vordergrund, Theoretische Überlegungen und systematische Beobachtungen zu verbinden, d.h. die eher ›europäische‹ Komponente der soziographischen Materialsammlung mit ›amerikanischen‹ Survey-Techniken zu kombinieren.
Lazarsfeld schreibt dazu:
»Der oft behauptete Widerspruch zwischen Statistik und phänomenologischer Reichhaltigkeit war sozusagen von Anbeginn unserer Arbeit ›aufgehoben‹, weil gerade die Synthese der beiden Ansatzpunkte uns als die eigentliche Aufgabe erschien.« (1975, S. 14)
Wir konnten die verschiedenen Ebenen unserer Untersuchung nicht in diesem Bericht aufheben. Aber auch unser Versuch
23
einer soziographischen Studie ist von der Dynamik zwischen den Ebenen geprägt, und die vier Regeln Lazarsfelds erscheinen uns immer noch überlegenswert und brauchbar.
3.1. Probleme des Zugangs; erste Daten
Der Grossteil der anfänglichen Arbeit floss in das ›Einleben‹ in Marienthal. Wir wollten Kontakte knüpfen und das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Diese ›Entry‹-Problematik wurde uns bewusst, als wir versuchten, uns in einer Wirtshauszusammenkunft vorzustellen. Niemand kam. Es gab eine Barriere gegen uns als Fremde, und wir hatten nichts Konkretes anzubieten. Ausserdem verfassten wir unsere Ankündigung auch auf jugoslawisch, was, was uns später gesagt wurde, in den Augen vieler Einheimischer ein ›faux pas‹ war, wo es doch um die Situation der Marienthaler gehen sollte. Wir sind zwar nach wie vor der Ansicht, dass die Probleme zwischen Einheimischen und Gastarbeitern zum Gesamtbild Marienthals gehören, aber ein guter Zugang war die Aktion offenbar nicht.
Sehr erfolgreich hingegen war eine von uns kurz darauf durchgeführte Ausstellung von Kinderphotos. Es ging darum, über die Marienthaler Kinder Zugang zu einer grösseren Schicht der Bevölkerung zu gewinnen, so, dass Kinder und auch Erwachsene und auch wir Spass daran hatten. Wir photographierten alle Kinder, die sich dazu bereit erklärten – insgesamt einhundertsechzehn – und vergrösserten die Photos zu grossformatigen Schwarzweissbildern. Diese photokopierten wir dann zweimal. Die Rückseite der einen Kopie, die die Kinder behalten durften, war mit einem Brief bedruckt, der unsere Gruppe und unser Anliegen erklärte.
24
Ein kurzer Fragebogen auf der Rückseite der anderen Kopie wurde uns ausgefüllt zurückgegeben. Mit der Frage: ›Was würdest du dir wünschen, wenn eine gute Fee dir drei Wünsche erfüllte?‹ versuchten wir, an die Originalstudie anzuschliessen (vgl. Jahoda et al., 1975, S. 75). Es besteht natürlich ein Unterschied zwischen den Weihnachtswünschen in einer besonderen Notzeit und den Wünschen, die von vornherein auch das Traumelement der guten Fee nicht ausschliessen sollten. Im Falle der Weihnachtswünsche 1931 wurde der Wunschzettel unter einem Nützlichkeitsstandpunkt verfasst: ein warmer Mantel, neue Augengläser etc. Die Kosten dieser Wünsche betrugen damals 12 Schilling, im Gegensatz zu 36 Schilling in Orten der Umgebung. Was wünschen sich Marienthaler Kinder heute? Dreiunddreissig möchten ein Fahrrad, fünfzehn ein Moped, achtzehn ein Auto, wobei das Fabrikat oft spezifiziert wurde, hauptsächlich Porsche und BMW; sechzehn wollen eine Stereoanlage, fünfzehn ein Haus mit Schwimmbad – das ist übrigens der Hauptwunsch in gesamtösterreichischen Befragungen. Elf möchten viel Geld. Interessant war für uns festzustellen, inwieweit sich in der ›ungleichzeitigen‹ Arbeitersiedlung auf dem Land ein allgemeines Konsumdenken etabliert hat. Erst in zweiter Linie kamen die Wünsche, die einen persönlicheren Charakter hatten, darunter Geschwister, einen treuen Freund, Tiere, ein ›Zimmer für mich allein‹. Ein Elfjähriger wünschte sich einen schönen Traum.
Mit Hilfe der Kinder planten wir dann eine Ausstellung aller Photos in den Fenstern der Hauptstrasse von Marienthal. Beim Auswählen und Aufhängen hatten wir wieder viele Kontaktgespräche, stiessen durchaus auch auf Unverständnis und Ablehnung. Ohne die Kinder wäre die Ausstellung nicht so erfolgreich gewesen. Sie begleiteten uns, erklärten uns die Nachbarschaft, wussten, bei welchen anderen
25
Kindern und Eltern wir auf Kooperation stossen würden. Das komplizierte Netz der Kinderfreundschaften und der sozialen Diskriminierung wurde deutlich.
An einem Sonntag wurde schliesslich die Photoausstellung vom Gramatneusiedler Vizebürgermeister [d.i. Leopold Zolles] eröffnet. Die Bilder blieben eine Woche lang in den Fenstern hängen. Am Abend des letzten Tages zeigten wir die bisher von uns produzierten Videobänder, darunter auch die von den Ausstellungsvorarbeiten. Etwa einhundertfünfzig Bewohner kamen und sahen sich die Bänder im Freien an. Seit der Ausstellung waren wir den Marienthalern bekannt. Die Kinder wurden auch über diese Aktion hinaus zu unseren ständigen ›Mitarbeitern‹.
Ein letztes Beispiel unserer Einführungsarbeit sei hier nur kurz skizziert: Der Fussballklub ASK Marienthal hat eine wichtige Funktion in der Gemeinde. Das sonntägliche Spiel gehört zum selbstverständlichen Wochenrhythmus der Marienthaler. Freundschaftsgruppen entwickeln sich aus dem Vereinsleben, und der Klub kümmert sich um fünf Jugendmannschaften. Wir nahmen an einigen Vereinssitzungen teil, interviewten die Funktionäre und nahmen das erste Saisonspiel auf Videoband auf. Dieses Band zeigten wir dann auf dem Gramatneusiedler Volksfest, wodurch wir auch in dem anderen Teil des Ortes über das Gemeindeamt hinaus bekannt wurden.
26
3.2. Der Fragebogen
Im weiteren Verlauf unserer Arbeit wollten wir zu den uns interessierenden Themen systematisch Information sammeln. Trotz vieler, zum Teil berechtigter methodischer Einwände hatten wir beschlossen, zu diesem Zweck eine Fragebogenuntersuchung an einer Stichprobe durchzuführen, und zwar aus folgenden Gründen:
(1) Die Methode der Fragebogenerhebung ist inzwischen so bekannt, dass bei den Bewohnern ein Vorverständnis von unserer Vorgangsweise vorausgesetzt werden konnte (wenn auch das Misstrauen gegenüber möglichem Kaufzwang o.ä. manchmal blieb). Die oft erwähnte und auch kritisierte Objektivierung der Beziehung zwischen Fragenden und Befragten bedeutet auf der anderen Seite – und zwar gerade im Gegensatz zu der eher informellen Atmosphäre offener Gespräche – die Möglichkeit einer systematischen Erforschung von Meinungen und Einstellungen, bei der es uns durchaus auch auf die öffentlich vorgetragene Aussage ankam und nicht auf die ›Abweichungen‹, die dann eher in weiterführenden Gesprächen zugestanden wurden.
(2) Die Systematik der Fragebogenerhebung, die den Ansprüchen einer repräsentativen Stichprobe zu genügen hatte, zwang uns auch, in Bereiche des Industriedorfes vorzudringen, die sonst – bewusst oder unbewusst – von uns vermieden worden wären. Mit dem Fragebogen wurden wir immer wieder bei Bewohnern vorstellig, die ursprünglich nicht zu einem Gespräch bereit gewesen wären, deren Beitrag für uns jetzt aber aufgrund der Repräsentanzforderungen der Erhebung notwendig geworden war.
27
(3) Das gemeinsame Ausfüllen der Fragebogen gab uns ausserdem Gelegenheit für die als ›Spill-over‹ bezeichnete zusätzliche Information. Sie gab Aufschluss über soziale oder individuelle Problematiken, die durch das grobmaschige Netz des Fragebogens gerutscht waren, aber ohne dessen Systematik auch nicht zur Sprache gekommen wären. Die Spill-over-Informationen standen häufig im Widerspruch zu dem im Fragebogen ›angekreuzten‹ Haltungen, beispielsweise in der Gastarbeiterfrage, bei der die offizielle tolerante Einstellung mit halbvertraulichen Randbemerkungen kontrastierte.
Methodologische Untersuchungen zum Problem der Erwünschtheit von Antworten (social desirability; yes-saying effect u.ä.) weisen auf diese Diskrepanz hin. Gerade deswegen aber bleibt die Fragebogeninformation auch brauchbar: Sie vermittelt, welche Einstellungen sozial wünschenswert sind, im täglichen Leben aber nicht immer nachvollzogen werden.
Die 157 Items des Fragebogens sind nach folgenden Kategorien gegliedert:
Persönliche Daten; Haushaltsangaben, Wohngeschichte und -kategorien; Ausbildung, Perioden von Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit, Hausarbeit; Monatsbudgetierung; Konsumverhalten und -wünsche, Freizeit, Urlaub; soziale Aktivitäten: Verwandte, Freunde, Nachbarn; politische Interessen und Aktivitäten; Haltung zur Gewerkschaft; Kirche, religiöse Anschauungen; Gesundheitsprobleme; Haltung zu Gastarbeitern.
Die Items wurden im Frühjahr 1980 getestet, die Interviews im Sommer und Herbst 1980 durchgeführt.
28
3.3. Oral History
Die von den Fragebogen ausgehenden Gespräche, die halbstrukturierten Interviews und viele sonstige Begegnungen mit Marienthalern lassen sich unter dem Begriff der ›Oral History‹ zusammenfassen. Darunter ist die mit sich erinnernden Zeugen durchgeführte ›Geschichtsschreibung von unten‹ zu verstehen, die es uns ermöglichte, die durchwegs anonym und ›unwichtig‹ gebliebenen Zeugnisse und Zeugen der fünf Jahrzehnte seit der alten Studie für unser Porträt heranzuziehen. Schon in die kurze Geschichte des Ortes in der Einleitung gingen ihre Informationen ein, und das Autobiographische in den Gesprächen half uns bei der Auswahl exemplarischer Fallstudien. Auch Lazarsfeld wies übrigens auf die nahe liegende Möglichkeit der Interviews hin (wie sie 1932 ja auch wahrgenommen wurde), während Verifizierung durch Kontrollgruppen oft nur ›pseudowissenschaftliches Vorgehen‹ sei (vgl. Lummis, 1980, S. 288).
Wir versuchten, uns der von Geschichtsforschern aufgezeigten Probleme der Oral History bewusst zu sein: dass man quasi wie ein Psychotherapeut ohne Auftrag in das Leben der Angesprochenen interveniert; dass man nur das hört, was man hören will; und dass man das Gehörte unkritisch glaubt. Dazu können wir anführen, dass wir einerseits in den Eingangsgesprächen und der Kontaktnahme mit der Bevölkerung unser Forschungsinteresse deklariert haben und jedem offengelassen haben, wieviel er mit uns bereden wollte. Andererseits gab es eben durch den Fragebogen die Möglichkeit, das Subjektive mancher Angaben von dem allgemein Verifizierbaren zu trennen.
29
3.4. Die Stichprobe
Zunächst stellte sich uns die Frage, was heute überhaupt als Marienthal bezeichnet werden kann. Politisch gibt es den Ortsteil nicht. Er ist ein informeller Teil der 2000–Einwohner-Gemeinde Gramatneusiedl, deutlich abgehoben nur durch die Reihenhäuser der alten Siedlung. Der erwähnte Ring um diesen Kern, bestehend aus Gemeindebauten, Genossenschaftssiedlung und Eigenheimen, gilt aber teils aus geographischen Gründen, teils wegen der Geo-Mobilität der Marienthaler heute auch bei vielen als Teil Marienthals. Wir bezogen also Kernbewohner sowie diejenigen Gemeindebau- bzw. Eigenheimbewohner in die Stichprobe ein, die aus Marienthal stammten. Aus der Bevölkerung von knapp 1000 ergab sich eine nach Alter und Geschlecht stratifizierte Stichprobe von 63, aus der wir 7 Jugoslawen ausschlossen, um vor allem in Einstellungsfragen eine thematische Komplikation zu vermeiden.
Die Stichprobe bestand aus 31 männlichen und 25 weiblichen Marienthalern zwischen 15 und 83. Die Altersverteilung spiegelt die hohe Prozentzahl an Rentnern im Kern Marienthals wieder. Für die Datenanalyse entwarfen wir vier Altersgruppen:
|
(1) |
vor 1925 geboren – haben die Zeit der Arbeitslosigkeit bewusst miterlebt; |
|
(2) |
zwischen 1925 und 1945 geboren – haben die Krise und den Krieg oder zumindest das Nachkriegselend bewusst miterlebt; |
|
(3) |
zwischen 1946 und 1951 geboren – Nachkriegsgeneration; |
|
(4) |
nach 1951 geboren – Wohlstandsgeneration. |
30
Unsere Absicht bei der Schaffung dieser Altersgruppen war es auch, mögliche Effekte der ›Generationsbildung‹ zu untersuchen. Nach Mannheim (1964) bestimmt die Generationszugehörigkeit zusätzlich zur Klassenzugehörigkeit den Rahmen der Aktivitäten und Erfahrungen, die eine Gruppe von Leuten prägt. Schon in den ersten Gesprächen war uns klargeworden, dass die alte Marienthaler Generation, also ungefähr Gruppe (1), viel stärker gegenüber den Problemen der Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitslosigkeit und ökonomische Fragen im allgemeinen sensibilisiert ist als Angehörige späterer Generationen. Dass manche von ihnen einen Jahresvorrat an Dosennahrung im Keller aufbewahren, ist nur ein Zeichen dafür.
Die ökonomischen und klassensolidarischen Konzepte sind auch eine Folge der austro-marxistischen Kultur, aus der diese Altersgruppe noch stammt. Marienthal scheint in besonders deutlicher Weise die allgemeine österreichische Erfahrung zu wiederspiegeln, dass seit dieser generations- und klassenspezifischen Erfahrung eine nur partiell durchbrochene De-Ideologisierung und Depolitisierung erfolgt ist.
Von der Stichprobe leben acht allein, darunter fünf der sieben Verwitweten. Dreizehn haben einen Partner im Haushalt, dreizehn sind Familien mit drei Mitgliedern, zweiundzwanzig Familien mit vier oder mehr Mitgliedern. Einundzwanzig sind oder waren einmal Angestellte, dreizehn gelernte, vierzehn ungelernte Arbeiter. Acht haben bisher nicht gearbeitet (das sind Hausfrauen, die keine bezahlte Arbeit gehabt haben, und Schüler). In der Stichprobe sind keine Arbeitslosen.
31
4. Resultate
4.1. Soziale Distanz: Anomia
Zu den Schwerwiegendsten Begleiterscheinungen des Firmenzusammenbruchs 1931 zählte der Verlust eines allgemein verbindlichen sozialen und kulturellen Lebens und eines Gefühls von Zugehörigkeit. Wir finden diesen Verlust und die Trauer darüber in den meisten Gesprächen mit Alteingesessenen bestätigt. Er konnte durch den Aufschwung der Nachkriegszeit nicht beseitigt werden. Dass es dabei nicht einfach um die Nostalgie der Altgewordenen geht, lässt sich intuitiv erschliessen aus dem Vergleich mit sonst oft gehörten Klagen über den Verlust der guten alten Zeit, beispielsweise von Seiten Wiener Pensionisten aus dem Kleinbürgertum: Manche Klagen sind ähnlich (Erziehung heute, Wert des Geldes, Autoverkehr), aber selten hört man bei ihnen den speziellen Bezug auf eine ehemals intakte Gemeinschaft, wie sie die Marienthaler Arbeiter erlebten. Letztere erinnern eher an kürzlich veröffentlichte Gespräche mit alten Bewohnern von Wiener Gemeindebauhöfen.
Als Begleiterscheinung des Zerfalls eines organischen Ganzen und des Rückzugs aufs Private, Nicht-Soziale postulieren Soziologen den Zustand der ›Anomie‹ im Individuum. Das Begriffspaar Anomie und Eunomie bezeichnet den Entfremdeten, gesetzlosen bzw. den harmonischen, wohlgeordneten Zustand eines sozialen Gefüges. Der Anomie-Begriff wurde in der soziologischen Literatur zum ersten Mal bei Durkheim verwendet und von Srole (1956) als ›Anomia‹ für die empirische Forschung operationalisiert und begrifflich modifiziert. Die Variable bezeichnet den Grad der sozialen Distanz, die der Einzelne von der ihn umgebenden Gesellschaft wahrnimmt (vgl. MacIver, 1950).
32
In Sroles ursprünglicher Studie lautet die zentrale Hypothese, dass mangelnde soziale Integration mit einer abweisenden Haltung gegenüber Minderheiten verbunden ist. In unserer Arbeit wollten wir vor allem die Frage untersuchen, ob sich die Auflösung der Marienthaler Gemeinschaft in hohen Anomia-Werten niederschlägt, weiters, ob sich ein Zusammenhang zwischen anomischen Einstellungen und Einstellungen zu Minderheiten, in unserem Fall Gastarbeitern zeigt. Schliesslich lässt sich nach dem Anomie-Theorem auch ein Zusammenhang zwischen institutioneller Entfremdung und individuellen Leiden postulieren, was aber eine genaue Kalibrierung des Begriffs ›Individuelles Wohlbefinden‹ erfordert, die wir nur andeutungsweise vornehmen können.
Die von uns adaptierten fünf Anomia-Items lauten (mit den Prozentangaben unserer Stichprobe
|
(1) |
Die meisten Politiker interessieren sich nicht für die Probleme des kleinen Mannes |
||
|
|
|
stimmt |
stimmt nicht |
|
|
|
65 % |
34 % |
|
(2) |
Heutzutage muss man für den Augenblick leben und soll sich nicht um die Zukunft kümmern |
||
|
|
|
19 % |
81 % |
|
(3) |
Egal, was man hört, die Situation des kleinen Mannes wird schlechter und nicht besser |
||
|
|
|
37 % |
62 % |
|
(4) |
Es ist unfair, Kinder in die Welt zu setzen |
||
|
|
|
25 % |
75 % |
|
(5) |
Heutzutage weiss man nicht, auf wen man zählen kann |
||
|
|
|
49 % |
51 % |
33
Bei der Erstellung eines Anomia-Index (0 = niedrigst anomisch bis 5 = höchst anomisch) stellten wir fest, dass 11 der 56 Marienthaler aus der Stichprobe kein Item im anomischen Sinn beantworteten, während nur ein einziger den Wert 5 erreichte. Fast die Hälfte liegt in einer ›gemässigt anomischen‹ Mitte von 2–3. Wir hatten einen höheren Grad an Anomia erwartet, aber die Prozentverteilungen liegen nur unwesentlich höher als die der Springfield-Studie (Srole, 1956) und der Los-Angeles-Studie (Miller und Butler, 1966).
Die Altersgruppen (1) bis (3) weisen ähnliche Antwortmuster auf. Lediglich die nach 1951 Geborenen zeigen etwas niedrigere, aber nicht statistisch signifikante Werte. Was die Wohngebiete angeht, so sind die Eigenheimbewohner und auch die Bewohner der alten Wohnungen im Kern-Marienthal etwas anomischer als die Gemeindebau- und Genossenschaftsbaubewohner, was damit zusammenhängen könnte, dass letztere eher im allgemeinen Geschehen integriert sind. Alter und Erziehung müssten in diesem Falle mituntersucht werden, aber die kleine Zahl der Stichprobe verhindert solche Analysen höherer Ordnung. Auffällig aber ist, trotz mangelnder Vergleichbarkeit, dass zwei Drittel der Befragten sich von Politikern wenig erwarten. Nach all dem, was wir über die zwanziger Jahre gehört haben, scheint der politische Integrationsgrad in Marienthal doch um einiges gesunken.
Insgesamt stellten wir fest, dass der Versuch der globalen Erfassung einer Entfremdungs- oder Distanz-Dimension nicht sehr fruchtbar war oder zumindest keine überraschenden Ergebnisse zeitigte. Als wir die Anomia-Fragen stellten, waren wir mit einigen Aspekten des Soziallebens genug vertraut, so dass wir die Formulierung der Items eher als Einschränkung und unnötige Abstraktion von der Marienthaler Wirklichkeit empfanden. Bei einem impressionistischen Zugang sollten sich denn auch andere Phänomene als bedeutsam erweisen.
34
4.2. Soziale Beziehungen; die Netzwerke
Was das Sozialleben anbelangt, waren die Hinterhöfe der erste starke Eindruck, den wir von Marienthal gewannen (vgl. Exkurs 2 dieses Berichts). Bei schönem Wetter spielt sich das Leben der Kinder, das nachbarschaftliche Beisammensein, manchmal auch Haushaltstätigkeiten, in den Höfen, auf den Plätzen zwischen den Häusern und auf dem Abschnitt der Hauptstrasse ab, der von den Reihenhäusern flankiert wird. Quasi als Verlängerung dieser halböffentlichen Räume gibt es auch die Schrebergärten, die die Marienthaler aus der Vorkriegszeit herübergerettet haben. Sie werden jetzt noch zum Teil als Kleingärten geführt, teils dienen sie als Schuppen, hauptsächlich aber als Plätzchen im Grünen mit nachbarschaftlicher Transparenz nach allen Seiten hin.
Zunächst erschien es uns als undifferenziertes Beisammensein der Anrainer, und erst nach einiger Zeit begannen wir, die Abgrenzungen zwischen Jugoslawen und Österreichern und zwischen den Peer-Gruppen zu sehen. Wir lernten die Hierarchien der Wohnformen kennen, die sozialen Unterscheidungen nach oben, bis zu den grossen Villen hin, und nach unten zur Hinterbrühl, dem tatsächlich verslumten Teil Marienthals.
Es gibt in Marienthal drei Gasthäuser, zwei Cafés, den Sportklub, den Kinderspielplatz, kein Kino, keine Disco. Der Rahmen für Aktivitäten ausserhalb des Hauses und in Reichweite ist also relativ eng gesetzt. Viele der Feiern, Bälle Klubtreffen etc. finden im grossen Saal des einen Gasthauses statt, der zu Mittag als Kantine dient (und der schon zu Zeiten der alten Fabrik die von dem Angestelltensaal sorgfältig getrennte Arbeiterkantine war). Weiter weg, am anderen Ende des Ortes, liegt die der Schule angegliederte Mehrzweckhalle, ein eher kalter, moderner Bau,
35
der meistens für gemeindeoffizielle Anlässe zur Verfügung gestellt wird.
Das alles könnte über viele vergleichbar grosse Gemeinden gesagt werden. Was uns im Laufe unserer Arbeit besonders auffiel, und was für eine so sozialstrukturell gemischte Gemeinde wie Gramatneusiedl ungewöhnlich sein dürfte, ist die Stärke und Grösse der Familienbezüge und der mit ihnen zusammenhängenden Netzwerke.
Über ein Viertel unserer Stichprobe sieht täglich Verwandte (die nicht in der Wohnung wohnen), über ein Drittel fast jede Woche. Nur eine Frau sieht nie Familienmitglieder – sie sind alle weggezogen. Man trifft sich mit ihnen zu Hause (46 der 56 aus der Stichprobe) oder besucht sie (50). 40 geben an, dass sie gute Beziehungen zu ihren Verwandten haben, nur 4 sprechen von schlechten Beziehungen. Bei nichtverwandten Freunden sind die Zahlen übrigens ähnlich hoch, aber weniger verwunderlich, gemäss dem Satz: Die Freunde kann man sich aussuchen…
Unseren Eindrücken nach scheinen Familien oder Clans die eigentliche Stärke des Marienthaler sozialen Zusammenhalts und die Attraktion des Ortes auszumachen (vgl. auch die Fallstudie der Brüder K., weiter unten). Sie entschädigen für mangelnde Kulturangebote und teils auch für den eigenen Nichtaufstieg. Stellvertretend hat man Anteil am Wohlstand von Verwandten, badet im Swimming Pool, den man zu bauen mitgeholfen hat. In einem Fall reicht das Netzwerk von einem KP-Aktivisten über eine Geschäftsangestellte bis zu Besitzern einer Villa im Gramatneusiedler Teil des Ortes, die zwar kaum noch etwas mit Marienthal zu tun haben, aber ihre Familie und eigene Herkunft sehr wohl noch dort orten.
36
Im Sinne der soziologischen Netzwerktheorie sind die Bezüge unter den Mitgliedern zwar nicht ökonomisch egalitär, aber, und das wiegt Ungleichheit auf, von Solidarität geprägt, die sowohl mit der Idee der Grossfamilie als auch mit der Herkunft aus Marienthal zu tun haben dürfte.
Die familiären (und damit verbunden die ethnischen), die freundschaftlichen und die politischen Netzwerke überlagern sich stark und sind dafür verantwortlich, dass viele Marienthaler zwar aus den Altbauten ausziehen wollen und es auch tun (zumindest solange die hygienische Situation so problematisch ist), aber in der Nähe bleiben wollen. Die sozialen Beziehungen dürften sich also nicht so stark ändern. Allerdings entwickelt sich in den Eigenheimsiedlungen doch eine Eigendynamik, die viele nicht vorhergesehen haben und die sie stärker von der sozialen Umwelt abkapselt, als ihnen lieb ist. »Wir waren sehr froh, dass wir uns dieses Haus hier haben bauen können«, sagt uns ein sechsunddreissigjähriger Familienvater, der vor wenigen Jahren aus Kern-Marienthal auszog, »aber jetzt fehlt uns doch etwas. Wenn da nicht meine Schwester und ihr Schwager wären in der alten Siedlung, und die Eltern von meiner Frau, die auch einen Schrebergarten haben, wär's hier schon ziemlich langweilig.«
4.3. Einstellung zu Gastarbeitern
Die Einstellung gegenüber Minderheiten ist ein brauchbares Indiz der allgemeinen sozialen Toleranz in einer Gesellschaft. In Marienthal war es insbesondere die Haltung zu Gastarbeitern, die uns interessierte, und zwar sowohl im Zusammenhang mit der Geschichte des Ortes als auch als Teil des heutigen Bildes. Der Ort wurde ja selber zum
37
Gutteil von Auswärtigen besiedelt, von den böhmischen und mährischen Webern. Einige der älteren Bewohner sprechen noch tschechisch, und die meisten Namen verweisen auf die Herkunft. Noch in den dreissiger Jahren soll die Dominanz und der Zusammenhalt der Böhmen sehr stark gewesen sein; eine alte Marienthalerin fühlte sich damals von ihnen sogar in ihrer Arbeitssuche diskriminiert. »Die haben zusammengehalten, da ist niemand reingekommen.«
Dann kamen die Zeiten der Erwerbssuche, die ›Walz‹. Auch nach dem Krieg blieben viele bei ihren auswärtigen Tätigkeiten oder suchten sie dort. Dafür begannen andere aus den umliegenden Dörfern nach Marienthal zur Chemiefabrik zu pendeln. Der ethnische Charakter von Marienthal verblasste langsam.
Nun gibt es seit über zehn Jahren einen Zugang von Jugoslawen, die sich wegen der Arbeit, teils mit Familie in den Marienthaler Altbauten niederliessen. Sie haben einen eigenen Klub, eigene Veranstaltungen, und im Ortsbild schienen sie uns von Anfang an als kohäsive Gruppe, die sozial mehr miteinander zu tun hatten als die Einheimischen. Der Eindruck bestätigte sich mit der Zeit und hat mit Faktoren ethnischer Kultur wohl ebenso zu tun wie mit dem Altersunterschied, der zwischen der überalterten einheimischen Bevölkerung und den zugezogenen jungen Arbeitskräften herrscht.
›Offiziell‹ gibt es kaum Probleme zwischen Österreichern und Jugoslawen; auf allen Veranstaltungen, seien es Fussballspiele oder Weihnachtsfeiern, sind sie dabei. Aber sie erzählen von Problemen, die sie mit den Einheimischen haben. Wir wollen hier nicht die Arbeitssituation und ihre rechtlichen Schwierigkeiten beleuchten, die Themen eigener Untersuchungen sind. In Marienthal fiel uns vielmehr das buchstäblich hautenge Nebeneinander der Familien
38
auf, die gemeinsame Benützung von Brunnen, Hinterhöfen, Aussentoiletten, das Nebeneinander-, wenn nicht Miteinanderspielen der Kinder. Wie wirkt sich all das auf die Einstellung der Österreicher aus?
Wir adaptierten für unsere Zwecke die Antisemitismus-Skala der Studie über die autoritäre Persönlichkeit (Adorno et al., 1950) und konstruierten eine Skala von Einstellungen gegenüber Gastarbeitern (GA-Skala) aus acht Items:
Sagen Sie uns bitte, ob Ihrer Ansicht nach die folgenden Meinungen stimmen oder nicht:
|
(1) |
Wenn eine Wohngegend ihren guten Ruf behalten soll, sollten keine Gastarbeiter drin wohnen. |
|
(2) |
Gastarbeiter sollten nicht in höhere Positionen kommen. |
|
(3) |
Das Gastarbeiterproblem ist so gross, dass man es mit demokratischen Methoden wahrscheinlich nicht lösen kann. |
|
(4) |
Es gibt Ausnahmen, aber im allgemeinen sind Gastarbeiter alle gleich. |
|
(5) |
Gastarbeiter und Einheimische sollten nicht heiraten. |
|
(6) |
Die Vorurteile gegen Gastarbeiter kommen davon, dass diese selbst sich getrennt halten und Österreicher aus ihrem Leben ausschliessen. |
|
(7) |
Gastarbeiter sollten in bestimmten Gegenden nicht wohnen dürfen. |
|
(8) |
Der Anteil der Gastarbeiter in einem Betrieb sollte nicht zu hoch sein. |
Nur ein Marienthaler beantwortete alle Fragen negativ, d.h. gastarbeiterfeindlich. Insgesamt erschienen die Marienthaler als eher liberal auf der Ga-Skala. Ein Zusammenhang zwischen Gastarbeiter-Einstellung und Anomia liess sich
39
nicht finden, obwohl wir ihn aufgrund der Sroleschen Annahmen (1956) erwartet hatten. Möglicherweise aber sind Bildung und Alter stärkere Faktoren, die die Varianz in beiden Bereichen korrelativ ausmachen. Nicht-signifikante Trends zeigten sich auch in diesen Bereichen: Die Marienthaler mit höherem Bildungsgrad erscheinen etwas toleranter gegenüber Gastarbeitern als die anderen, ein Resultat, das man aus anderen Vorurteilsuntersuchungen kennt. In einigen Items insbesondere zeigte sich auch eine sehr viel tolerantere Haltung der Jüngeren (Altersgruppe 5) gegenüber der ältesten Gruppe.
Beispiel:
GA-Item ›Gastarbeiter sollten nicht in höhere Positionen kommen.‹
|
|
stimmt |
stimmt nicht |
|
Altersgruppe 1 |
39 % |
061 % |
|
Altersgruppe 3 |
00 % |
100 % |
Man hätte vielleicht annehmen können, dass die Jüngeren ja in einem direkten Konkurrenzverhältnis auf dem Arbeitsmarkt mit den Gastarbeitern stehen. Aber wahrscheinlich haben gerade der oft gemeinsame Arbeitsplatz und die häufigeren sozialen Kontakte unter Gleichaltrigen eine integrative Funktion erfüllt. Den Älteren bleibt lediglich die Erfahrung ›im Hof‹, wo die unterschiedlichen Standards nicht selten aufeinanderprallen.
Auf solche Probleme stiessen wir auch in den informellen Gesprächen, die wir mit beiden Seiten führten. Eine alte Marienthalerin, der eines der Häuser gehört, führte die Schwierigkeiten darauf zurück, dass die Jugoslawen das enge Zusammenleben mit den entsprechenden Hygienevorschriften nicht gewohnt seien und Jahre brauchten, um es zu erlernen. Sie meinte es zwar nicht diskriminierend,
40
sondern wollte lediglich auf die spezielle Marienthaler Situation hinweisen. Von Jugoslawen werden solche Hinweise aber sehr wohl als verletzend empfunden. Sie selber äussern sich je nach der ›Privatheit‹ der Gesprächssituation mehr oder weniger kritisch über ihre österreichischen Kollegen und Nachbarn.
Wir konnten nach mehreren Monaten in Marienthal, in denen wir eine Wohnung hatten, ein Gemeinschaftsklo und den Hof benutzen und bei vielen offiziellen und inoffiziellen Begegnungen dabeiwaren, keine ›Lösung‹ des Problems der verschiedenen (Sub-)Standards und ethnischen Codes sehen. Einige Hoffnung scheint uns in der relativen Integration vieler Jugendlicher zu liegen. Was die Sanierung der Altbauten in diesem Zusammenhang an Veränderungen bringt, bleibt abzuwarten.
Post Skriptum: Nachdem wir unsere Untersuchung fertiggestellt hatten, wurden einige österreichische und jugoslawische Arbeiter aus der Chemiefabrik entlassen. Die wirtschaftliche Krise hat auch in Marienthal erste Auswirkungen. In solchen Zeiten wird sich zeigen müssen, wie sehr die liberale Einstellung verankert oder nur Lippenbekenntnis ist.
4.4. Gesundheitsfragen
Unter Gesundheit verstehen wir das Fehlen subjektiv-beeinträchtigender, schädlicher physischer und psychosozialer Faktoren im Leben eines Menschen (vgl. WHO, o.D.). Aus technischen und konzeptionellen Gründen (unser Anliegen ist ein sozialpsychologisches und kein medizinisches) beschränken wir uns dabei auf die Selbstangaben der Bewohner; dabei entsprachen wir allerdings einer Forderung der
41
modernen Gesundheitsforschung, die die subjektive Befindlichkeit der Patienten wieder stärker betont. Als ›objektivierbare‹, wenn auch unüberprüfte Daten schlossen wir Fragen nach den Rauch- und Trinkgewohnheiten in den Fragebogen ein. Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit insgesamt sollte einen allgemeinen Indikator ergeben.
Zur Gesundheit im weiteren Sinne zählt die Verfügbarkeit und tatsächliche Nutzung einer medizinischen Versorgung und die Zufriedenheit mit ihr. Durch diese Fragebogen-Items, aber mehr noch durch die informellen Gespräche über das Thema erhielten wir detaillierten Einblick in die Problematik einer adäquaten Versorgung, vor allem in einer überalteten Gemeinde.
Bei der Frage nach dem allgemeinen Gesundheitszustand zeigte sich wieder, wie strukturierte Daten und unsere subjektiven Beobachtungen einander ergänzten. Wir erhielten zum einen die berichteten, d.h. von den Bewohnern selbst als erwähnenswert betrachteten Gesundheitsprobleme und ihre Einschätzung durch die Betroffenen, und durch den Gemeindearzt; zum anderen sind uns Probleme aufgefallen, die dann im Gespräch auch thematisiert werden konnten.
Im Detail berichteten 32 der arbeitenden 36 Marienthaler der Stichprobe, dass sie im vergangenen Jahr aus Krankheitsgründen der Arbeit fernblieben; bei 10 von ihnen waren es mehr als zwei Wochen. Im Krankenstand zu sein kann allerdings, wie wir einige Male feststellen konnten, das Recht bedeuten, sich um Renovierungsarbeiten oder den Hausbau zu kümmern. Aus der Freimütigkeit, mit der das uns gegenüber zugegeben wurde, lässt sich schliessen, dass kurze Krankenstände als Möglichkeit anderweitiger Arbeit toleriert werden. Allerdings handelt es sich dabei um Marienthaler, die in anderen Orten zur Arbeit gehen, was
42
eine Kontrolle ihres Krankseins erschwert. Arbeiter der Para-Chemie sind durch Kollegen einer grösseren Kontrolle ausgesetzt.
Über ›leichte‹ Krankheiten (Fieber, Bronchitis etc.) im letzten Jahr berichtete ein Viertel der Stichprobe, ein weiteres Viertel erwähnte schwere oder chronische Krankheiten (z.B. Arthritis, Nierenprobleme).
Wie oft brauchen Marienthaler den Arzt? Von 56 haben ihn 8 kein Mal im letzten Jahr gesehen, 31 ein paarmal, 14 alle paar Wochen, 2 fast jede Woche.
Ungefähr ein Drittel der Befragten musste in den zwölf Monaten zuvor ins Spital, wegen Knochenbrüchen, innerer Krankheiten, Geburten und einer Abtreibung.
Über die Hälfte erklärte, dass sie vom Gemeindearzt die nötige Versorgung erhalten, weitere 25 (zusätzlich) von auswärtigen Spezialisten. Insgesamt bezeichneten sich 7 als ›sehr zufrieden‹ mit der Gesundheitsversorgung in Marienthal (d.h. mit Arzt und Zugang zu Spezialisten und Spitälern), 30 waren ›zufrieden‹, 15 eher ›unzufrieden‹ und 4 ›sehr unzufrieden‹.
Die Unzufriedenheit ist etwas höher (wenn auch nicht statistisch signifikant abgesichert) als in vergleichbaren Umfragen, zu sagen, dass man es nicht allen recht machen kann, erklärt zu einem gewissen Grad das Ergebnis, die Unzufriedenheit resultiert nämlich, wie wir in den begleitenden Gesprächen erfahren konnten, aus unterschiedlichen Motiven. Manche finden z.B., dass der Arzt sich zuviel Zeit mit einzelnen Patienten nimmt, wodurch zuwenige in der Ordinationszeit drankommen; andere vermissen ein genügend langes Gespräch. Viele sind sich darin einig, dass ein
43
zweiter Arzt nötig wäre, aber geben zu, dass dies vor allem ein politisches Problem sei und nicht eines der persönlichen Leistungsfähigkeit. Ein zweiter Arzt müsste von der Gemeinde durchgesetzt werden und würde eine Halbierung der Krankenkasseneinkommen des jetzigen Arztes bedeuten.
Unsere Beobachtungen, die sich zum Teil in den Fragebogenantworten niederschlugen, beziehen sich hauptsächlich auf Alkohol- und Zigarettenkonsum. Fast die Hälfte der Stichproben berichtet von ›seltenen‹ bis zu ›häufigen‹ Fällen von Trunkenheit. Marienthaler erzählen uns manchmal mit einem Lächeln des Einverständnisses von ihrem letzten Rausch – Angetrunkensein ist fast eine Ehrensache, solang es nicht arbeitsunfähig und zum Alkoholiker macht. Einige unserer Gesprächspartner, darunter auch der Bürgermeister von Gramatneusiedl [d.i. Klaus Soukup; Anm. R.M.], meinen, dass das Problem nicht grösser sei als anderswo und dass ihm wahrscheinlich durch Aufklärungskampagnen nicht beizukommen sei. Eine alte Marienthalerin erinnert sich noch an die »Abstinenzlerfeldzüge der Partei« in den zwanziger Jahren. Damals sei der Alkoholismus wohl beträchtlich niedriger gewesen, aber es hätte eben auch anderes zu tun gegeben als nur Fernsehen und Wirtshaus.
Rauchen ist andererseits eine zwar ebenso weitverbreitete aber weniger akzeptierte Gewohnheit. Über ein Drittel der Befragten rauchen mehr als ein Paket am Tag und sind fast ausschliesslich der Meinung, das sei zuviel.
Der sogenannte ›Geisteszustand‹ wird hier nicht als etwas von der Gesundheit getrenntes gesehen. Wir gehen auf den Aspekt aus einem methodischen Grund gesondert ein:
Es gibt eine fortwährende Suche nach adäquaten Operationalisierungen von geistiger Gesundheit. In sie strömen philosophische, empirische, schliesslich auch standesideologische Prämissen ein. Die Mental-Health-Forschung und
44
-bewegung [!] im angelsächsischen Raum hat sich dabei bemüht, eine von Stigmata möglichst freie Betrachtungsweise anzuwenden. Unter ihren verschiedenen Versuchen, das Konzept empirisch und epidemiologisch fassbar zu machen, haben wir die Arbeit des Midtown-Manhattan-Studienteams für unsere Untersuchung angewandt. Der dort konstruierte Mental-Health-Index beschreibt »verschiedene Grade manifester Symptombildung und angenommener emotionaler Unfähigkeit, die Rollen eines erwachsenen Lebens auszufüllen.« (Srole et al., 1975, S. 163) Die zugrundeliegende positive Definition geistiger Gesundheit ist »ein Freisein von psychiatrischen Symptomen und ein optimales Funktionieren des Individuums in seiner sozialen Umgebung« (ebda, S. 176). Es ist die Betonung des sozialen Funktionierens, die den Index, im Zusammenhang mit Fragen der Anomie bzw. der möglichen allgemeinen Entfremdung in der Gemeinde, für uns interessant gemacht hat.
Der Index beruht auf den Auswertungen des epidemiologischen Midtown-Fragebogens durch zwei unabhängig voneinander arbeitende Psychiater. Ihre Beurteilungen wurden aus den Fragebogen durch Computer simuliert, wobei die Bedeutung der einzelnen Fragen mit Hilfe von Regressionsanalysen unterschiedlich gewichtet wurden. Die für eine Vorhersage wichtigsten Fragen sind:
1) Würden Sie sich als nervös bezeichnen?
2) Fällt es Ihnen schwer, einzuschlafen?
3) Haben Sie einmal einen Nervenzusammenbruch gehabt?
4) Trinken Sie manchmal mehr, als Ihnen guttut?
Der aus ihnen resultierende MH (für Mental-Health)-Index approximiert zu einem hohen Grad die komplexen Beurteilungen durch die Psychiater. Die Marienthaler Daten wurden in drei Gruppen geistiger Gesundheit bzw. geistigen Funktionierens unterteilt.
45
Gemäss der MH-Skala können 14 aus der Stichprobe als ›symptomfrei‹ bezeichnet werden, 18 weisen ein ›mittleres Niveau‹, 24 ein ›hohes Niveau‹ möglicher Störungen auf. Diese Werte lassen sich allerdings nicht mit anderen Ergebnissen der Midtown-Skala vergleichen, und für detaillierte Beurteilungen des geistigen Gesundheitszustandes ist die Stichprobe zu klein. Lediglich Trends lassen sich aus den Kreuztabulierungen mit anderen Daten ablesen. So scheinen die älteren und im alten Marienthal lebenden unter den Symptomfreien unterrepräsentiert zu sein.
Eine bessere Kenntnis der Probleme und Anliegen ermöglichen uns wiederum Gespräche mit Bewohnern und vor allem mit dem Arzt. Wir erfahren vom Gemeindearzt, der seit 1950 in Gramatneusiedl arbeitet, warum er sich nach Ansicht einiger Marienthaler zuviel Zeit mit den Patienten nimmt: Cirka die Hälfte der Leute, so schätzt er, kommt zu ihm, um über konkrete Probleme reden zu können. Nur fünfmal in seiner dreissigjährigen Praxis im Ort hat er Leute in psychiatrische Behandlung weiterschicken müssen. Er hält viel vom gemeindenahen Kontakt und vom guten Zureden.
Frauen bezeichnet er als das konstitutionell und psychologisch schwächere Geschlecht, was von den Hormonen herrühre. Ihre ›biologische‹ Rolle erkläre gewisse emotionale Schwächen; die ›Krankheit der Emanzipation‹ sei noch nicht in die Gemeinde gedrungen. Jenseits dieser ideologischen Meinungen aber scheint der Gemeindearzt für Marienthal eine ähnliche Rolle zu spielen, wie bis vor kurzem auch der verstorbene katholische Priester des Ortes: Jemand, der nicht ›einer der unsrigen‹ war, aber zu dem man mit Problemen gehen konnte, der sich nicht beruflich abkapselte, sondern in Gesprächen praktisch helfen wollte.
46
4.5. Arbeitslosigkeit
Zur Zeit unserer Arbeit gab es in Marienthal eine verschwindend kleine Anzahl von Arbeitslosen, die aus der Randschicht von Alkoholikern kamen und auch bei einem entsprechenden Stellenangebot nicht in einen Arbeitsprozess integrierbar gewesen wären. Teil unseres Forschungsinteresses war aber die allgemeine Einstellung zum Problemkomplex Arbeitslosigkeit (als Bedrohung, als Mittel sozialer Kontrolle, als negative Beschreibungskomponente der Kategorie Arbeit). Zudem hatte die Frage nach der Arbeitslosigkeit eine strategische Funktion innerhalb unserer Forschungsarbeit. Sie war der Anlass für die Methode der ›Oral History‹ und bestimmte weitgehend, wie wir in der Ortschaft wahrgenommen wurden: Wir waren diejenigen, die sich für persönliche Erinnerungen und Geschichten aus der Zeit der grossen Arbeitslosigkeit interessierten.
Der Fragebogen enthält zum Thema zunächst ›objektive‹ Fragen an Ortsansässige: Waren Sie in den dreissiger Jahren arbeitslos? Und wenn die Frage altersmässig nicht zutraf: Waren Ihre Eltern damals arbeitslos? Von den acht befragten, die 1930 im erwerbsfähigen Alter standen, sagte nur einer, dass er lange arbeitslos war. Die Jüngeren hörten cirka zur Hälfte von längerer oder wiederholter Arbeitslosigkeit ihrer Eltern.
Das Verhältnis 1:7 in der ersten Frage, verglichen mit den 75 % Arbeitsloser laut Studie von 1933, mag ein statistischer Zufall sein. Möglich ist aber auch, dass die eigene Arbeitslosigkeit bagatellisiert oder verdrängt wurde, weil sie als Zeichen mangelnder Tüchtigkeit gewertet werden könnte. Arbeitslosigkeit war und ist ein Stigma und wird entsprechend beurteilt. Auf die Frage: »Wenn heute jemand arbeitslos ist, ist das Ihrer Meinung nach
47
seine eigene Schuld oder von den ›Umständen‹ verschuldet?« antworteten 47 von 56 mit ›Eigene Schuld‹. Dieselben meinen zwar, dass es in den dreissiger Jahren den Umständen zuzuschreiben war, aber kaum einer kann im offenen Teil des Fragebogens diese ›Umstände näher beschreiben oder erklären. Und selbst für damals gilt in den Köpfen von vielen: »Wenn jemand wirklich arbeiten wollte, der hat schon was gefunden.« ›Etwas finden‹ bedeutete damals, weite Fahrrad- oder Fusswege zur Arbeit in Kauf nehmen oder überhaupt wegzuziehen. Bei einem Überangebot an Arbeitswilligen gab es ausserdem extrem niedrige Löhne. Oft war dann zwischen dem Haushaltsbudget von Familien, die ein arbeitendes Mitglied hatten und solchen, die von der Arbeitslosen- oder Notstandsunterstützung leben mussten, kaum ein Unterschied.
Der Satz: »Ich habe immer Arbeit gehabt« fällt oft und wird mit Stolz ausgesprochen. Man ist nicht jemand, der trotz der widrigen Umstände noch Glück gehabt hat, sondern eben der Tüchtigere, ein Mensch mit dem notwendigen Arbeitethos.
In den offenen Interviews stellten wir auch die Frage nach Konzentrationslagern, von denen es einige kleine in der Umgebung gab, in Wolkersdorf und Lanzendorf. Manche sagten, dass sie von ihnen wussten, und fügten dann hinzu: »Da sind Leute hingekommen, die nicht arbeiten wollten.« Die tödliche Lüge, die hinter dem Sinnspruch ›Arbeit macht frei‹ stand, soll hier gar nicht zur Sprache kommen. Seit der Industrialisierung scheint die Internierung, Disziplinierung und Entmündigung von Arbeitslosen und Arbeitsunwilligen als gerechtfertigtes Mittel zum Schutz der moralisch-ethischen Grundpfeiler der Gesellschaft (vgl. Garraty, 1978).
48
Die Einstellungsfrage: »Wer heute arbeitslos ist, der will nicht arbeiten. So jemand gehört in ein Arbeitslager.« wird von immerhin einem Viertel der Stichprobe zustimmend beantwortet.
Marie Jahoda – seit der Marienthaler-Studie eine anerkannte Expertin auf dem Gebiet von Arbeitslosigkeit und Arbeit – meinte 1980 anlässlich eines Vortrags im Rahmen des Kautsky-Kreises in Wien:
»Es gibt fünf Konsequenzen, die eine Arbeit im sozialpsychologischen Sinn mit sich bringt und die über die Funktion des lebenserhaltenden Broterwerbs hinausgehen:
|
(1) |
Die Arbeit strukturiert die zur Verfügung stehende Zeit. |
|
(2) |
Die Arbeit erweitert den Lebenshorizont über den der engsten Familie hinaus. |
|
(3) |
Die Menschen erkennen durch die Arbeit, dass es Tätigkeiten gibt, die über die Kapazität des Einzelnen hinausgehen und nur gemeinschaftlich erfüllt werden können. |
|
(4) |
Die Arbeit verleiht Status und Identität. |
|
(5) |
Die Arbeit zwingt den Menschen zur Aktivität.« |
Sie zitiert in diesem Zusammenhang auch Freud, der gesagt hat: »Die Arbeit ist des Menschen stärkste Bindung an die Realität.« Folgt man diesen Argumenten zum Stellenwert der Arbeit, so wird deutlich, dass ein noch so engmaschiges Netz von materieller Arbeitslosenunterstützung die eigentlichen Probleme etwaiger zukünftiger Arbeitslosigkeit nicht aufzufangen vermag. Es scheint notwendig, den Stellenwert der erwerbstätigen Arbeit im Lebenszentrum neu zu überdenken und Bewusstseinsstrukturen zu entwickeln für Tätigkeiten und Daseinsformen, die die oben erwähnten fünf Kriterien als Minimalforderungen eines befriedigenden sozial integrierten Lebens gewährleisten. Das
49
heisst, dass die gesellschaftliche Position von Arbeit und Vollbeschäftigung früher oder später einer revidierten Einschätzung weichen musste. Es wäre wünschenswert, wenn im Bewusstsein der Bevölkerung dann andere Bewertungsstrategien zum Tragen kämen, damit das Festhalten am moralischen Wert der Arbeit als eigentlichem Lebenszweck nicht als Bumerangeffekt auf arbeitslose Teile der Bevölkerung zurückschnellt. In Marienthal, von dessen Bevölkerung man vielleicht erwartet hätte, dass sie durch leidvolle Erfahrung die moralische Bewertung von Arbeitslosigkeit hätte revidieren können, lebt das Stigma kaum angekratzt als soziale Kontrolle und psychologische Bewertung weiter.
Zwischen 1929 und 1934 wurden die politischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Organisationen in Marienthal aufgelöst. Damit ging auch ein Prozess sozialpsychologischer Natur einher, nämlich die diskriminierende, nicht mehr solidarische Wahrnehmung des anderen als Arbeitslosen. Die Arbeit war kollektiv, auch mit den entsprechenden Zeichen der Gemeinsamkeit: Aufmarsch, Treffen etc. Arbeitslos war jeder allein (womit nicht die gegenseitige Hilfe von Freunden und Nachbarn in Frage gestellt werden soll). Es war ein Prozess der Verwilderung. »Auf die anderen war eben kein Verlass«, erinnerte sich ein dreiundneunzigjähriger ehemaliger Gewerkschafter in einem Gespräch mit uns. »Sowie es aus ist mit der Arbeit, ist es auch aus mit der Solidarität der anderen.«
Das ist neben härteren Lebensbedingungen die eigentliche Bedrohung der Arbeitslosigkeit: die abrupte Zerstörung der sozialen Bezüge, eine Bedrohung, die wir hier zusammengefasst durch die Stigmatisierungshypothese und ihre Folgen zu erklären versuchten.
50
Das Problem lässt sich bei den Autoren der ursprünglichen Untersuchung verfolgen. Sie konnten aus der sozialdemokratischen Tradition, in der Arbeit als Wert an sich erscheint, nicht ausbrechen und stellten ihre ganze Untersuchung unter das Primat dieser Einstellung. Ohne Arbeit ist die Arbeiterschaft machtlos, da sie ihres Hauptkampfmittels beraubt ist. Dass diese Mittel nur in spezifischen historischen Perioden seine Richtigkeit hat, wird von ihnen u.E. nicht genügend reflektiert.
»Indem die Sozialisten diesen Allgemeinbegriff (der Arbeit) beibehalten, machen sie sich zu Trägern der kapitalistischen Propaganda… In einer vernünftigen Gesellschaft verändert der Begriff der Arbeit seinen Sinn.«
(Horkheimer, 1934, S. 181)
4.6. Politik und Gewerkschaft
4.6.1. Interessenvertretung durch Parteien:
In der ursprünglichen Untersuchung wurde der Zerfall der politischen und gewerkschaftlichen Organisationen und die Folgen für die ›müde Gemeinschaft‹ Marienthal beschrieben. Heute, fünfzig Jahre später, fragen wir nach dem Stellenwert der Politik für die Bewohner:
»Was können Sie uns für ein Problem in Marienthal nennen, das Ihrer Meinung nach alle angeht? Haben Sie einmal versucht, dieses Problem vorzubringen? Bei der Gemeinde, bei öffentlichen Gelegenheiten? Glauben Sie, dass Gemeindepolitiker sich für das Anliegen einsetzen würden? Eher Gemeindepolitiker von der SPÖ oder der ÖVP?«
51
Mit der ersten, offenen Frage konnten die meisten nicht viel anfangen. Ja, die alte Siedlung muss revitalisiert werden. Aber das ist ja geplant. Das Problem mit den Brunnen wurde von einigen Bewohnern der alten Siedlung erwähnt, d.h. das Dilemma zwischen dem Fliesswasser draussen und dem geplanten komfortableren, aber teuren und angeblich nicht so guten Wasser nach der Revitalisierung. Auch zwei Eigenheimbewohner nannten das Wasserproblem, als Alternative zwischen eigenem Brunnen und verordnetem Anschluss. Ansonsten fiel den Marienthalern der Stichprobe kein Problem ein. Wieder war es so, dass andere Anliegen eher in den späteren Gesprächen genannt wurden, etwa das Fehlen einer Ampel im Ort, durch den die Autos regelmässig mit überhöhter Geschwindigkeit rasen, oder die wachsenden Probleme der Zersiedlung vor den Toren der alten Gemeinde. Ein jüngerer Marienthaler erwähnte auch den ehemaligen Park, der noch immer eine Rolle spielt als Beispiel der ›Verschacherung‹ des ganzen Ortes.
Ob die Anliegen bei der Gemeinde vorgebracht worden seien, beantwortet je cirka ein Viertel mit ›ja / öffentlich‹, ›ja / privat‹ und ›nein‹.
Auf die Anliegen angesprochen, meinte der Bürgermeister von Gramatneusiedl [d.i. Klaus Soukup; Anm. R.M.], dass es schwer sei, den Weg von einer Anregung zu einer permanenten Einrichtung mit andauernder Mitarbeit zu gehen. Gerade auch was den verwilderten Park anbelangt: Die Gemeinde sei einmal auf den Wunsch nach Bänken eingegangen und habe auch Mittel für eine kleinere Gartenanlage zur Verfügung gestellt, aber nach kurzer Zeit sei das Interesse der Bevölkerung erlahmt, die Bänke seien zerschlagen worden. Während das letztere wohl die Aktion einiger Jugendlicher war, schien uns die Frage nach dem, auch politischen, Interesse der Bevölkerung eine eingehendere Untersuchung wert. Ohne die Schichten in Marienthal über einen Leisten schlagen zu wollen,
52
machten wir doch eine immer wiederkehrende Erfahrung: dass nämlich viele alte Bewohner nichts mit Politik zu tun haben wollten, sich als unpolitisch oder uninteressiert bezeichneten, um dann aber durchaus politisch überlegt zu debattieren. Die anfängliche Abwehr ist nur zum Teil auf unsere Rolle als Nicht-Bewohner zurückzuführen. Zum anderen Teil dürften die Enttäuschungen und politischen Niederlagen von seinerzeit für die Skepsis verantwortlich sein.
Gramatneusiedl ist heute noch eine von den Sozialdemokraten geführte Gemeinde. Vor allem in Marienthal meinen fast alle, dass die SPÖ eher ihre Interessen vertritt. Im Gemeinderat von Gramatneusiedl entfielen 1978 44 [recte 14; Anm. R.M.] Sitze auf die SPÖ, 6 Sitze auf die ÖVP und 1 Sitz auf die KPÖ. Wie überall in Österreich hat die KP Stimmen verloren, aber in dieser Gemeinde ist der Verlust besonders stark. Historisch gesehen waren die Kommunisten eine politisch wirksame Kraft, und es kursieren noch anerkennende Geschichten alter Sozialdemokraten über die damaligen KP-Mitglieder, die als noch radikaler galten. Eine systematische politische Auseinandersetzung scheint es aber in den Zeiten vor und während der Illegalität nicht gegeben zu haben. Die gegenseitige Ablehnung nahm seither zu. Durch ihre aussenpolitische Haltung nach dem Krieg, vor allem aber durch das Verhalten der russischen Soldaten geriet die KPÖ in Marienthal bald ins politische Abseits. Einen ›blinden‹, von irrationalen Vorstellungen bestimmten Antikommunismus konnten wir allerdings nicht bemerke. Die KPÖ wird zwar abgelehnt, aber noch als Arbeiterpartei bezeichnet. Es gibt übrigens eine von der KPÖ herausgegebene Bezirkszeitung, in der regelmässig Berichte über Marienthal zu finden sind; sie wird gekauft und liegt im Gasthaus auf.
53
4.6.2. Interessenvertretung durch Gewerkschaft
10 % unserer Stichprobe im erwerbsfähigen Alter sind in der Gewerkschaft aktiv, 50 % sind Mitglieder, ein Viertel war einmal Mitglied, ist aber ausgetreten, zum Teil weil sie die eigentlichen Vorteile nicht sehen konnten. Auch manche Mitglieder wiesen auf die Sinnlosigkeit gewerkschaftlicher Tätigkeit hin. Die empirischen Daten sind hier allerdings nicht systematisch genug, um über das Ausmass dieser skeptischen Einstellung Aufschluss geben zu können.
»Würden Sie sagen, dass die Gewerkschaft heute ausreichend für die Interessen der Arbeitnehmer eintritt?« Fast die Hälfte bejahte diese Frage, 29 % meinen ›teilweise‹, 15 % ›nein‹. 12 % hatten keine Meinung. Entscheidend für eine Beurteilung gewerkschaftlicher Aktivitäten ist die sozialpartnerschaftliche Realität im einzigen grossen Betrieb Marienthals, der Para-Chemie, und auch in den anderen Firmen von Gramatneusiedl und Umgebung. Während unserer Untersuchung gab es Vollbeschäftigung im Betrieb. Ein fünfzehnter Monatslohn konnte ausgezahlt werden. Angesichts solcher Fakten lässt sich nur schwer auf die politische Brauchbarkeit und Wirksamkeit der Gewerkschaft schliessen. Ob sie Vorteile bietet, liesse sich eher in einer Situation erfragen, in der die Interessengegensätze klarer sichtbar werden, beispielsweise bei einer Rationalisierung des Betriebs oder bei Arbeitskonflikten.
»Im Vergleich zu früher: Wie, meinen Sie, vertritt die Gewerkschaft heute die Interessen der Arbeitnehmer?« 37 % sahen eine bessere Wahrnehmung der Interessen, 18 % eine schlechtere, 13 % eine unveränderte. 22 % hatten keine Meinung dazu.
54
Die Gruppe der Unentschiedenen scheint gerade hier gross zu sein. Wir haben das Gefühl, dass es sich bei ihnen nicht um Desinteresse handelt, sondern um eine rational begründete »Nicht-Meinung«. Die Situation und Funktion der Gewerkschaft sind für die meisten Marienthaler nicht so einfach zu beurteilen. Einer der Gewerkschaftsfunktionäre, ein durchaus politisch denkender und engagierter Mensch, meint:
»Der Arbeiter in unserem Betrieb ist oft besser dran als der Werksleiter. Er hat nicht mit den alltäglichen Problemen eines risikoreichen Unternehmens zu kämpfen.«
Diese Aussage wird von einem ehemaligen KP-Gemeinderat zwar heftig bestritten. Aber auch er ist der Meinung, dass der Betrieb letztlich ein Segen für Marienthal ist. Unter dem Primat der Arbeitsplatzsicherung verliert die Frage nach politischen oder gewerkschaftlichen Alternativen tatsächlich an Relevanz, sie ist auch auf der Phantasieebene nicht anzutreffen.
4.7. Kirche
Als wir mit Marie Jahoda über unser Vorhaben in Marienthal sprachen, interessierte sie eine Frage ganz besonders: Ob es etwas gibt, das die einigende und leitende Funktion der Sozialistischen Partei übernommen hat, vielleicht die Kirche?
Auf der Ebene manifesten Verhaltens sind die Marienthaler aber Atheisten geblieben. Über ein Drittel der Stichprobe gibt zwar ›Katholisch‹ als Glaubensbekenntnis an, aber keiner geht regelmässig in die Kirche. Allerdings lassen viele ihre Kinder taufen. Geburt, Hochzeit, Begräbnis zählen auch in Marienthal zu den Ereignissen, die man gern mit kirchlichen Ritualen begeht.
55
Es gibt keine freidenkerischen Aktivitäten mehr in der Arbeitergemeinde, und kaum eine explizite Feindseligkeit gegenüber der Kirche. Der schon erwähnte, vor einigen Jahren verstorbene, Pfarrer [d. i Georg Grausam; Anm. R.M.] war ein beliebter Mann in ganz Gramatneusiedl. Er scheint ein richtiger Volkspfarrer gewesen zu sein, wie viele zu berichten wissen. Der neue Pfarrer [d.i. Herwig Porstner; Anm. R.M.] kommt aus dem Nachbarort und ist sich der schweren Nachfolge bewusst, die er angetreten hat. Seine Pfarre legt Wert auf Gemeinde- und Fürsorgearbeit, bei der Kontakt grossgeschrieben wird und die Predigt demgegenüber in den Hintergrund tritt.
4.8. Fallstudien
Verallgemeinernde Aussagen, Reduktion der Beobachtungen auf wenige erklärende Begriffe und statistische Inferenz zählen zu den Grundannahmen der modernen nomothetischen Wissenschaft. Die Beschäftigung mit Individuellem – sei es Personen oder Phänomenen – wie sie in der ideographischen wissenschaftlichen Orientierung vertreten wurde, trat demgegenüber in den Hintergrund. In der Sozialforschung spielt sie eine Rolle hauptsächlich als ›Analyse abweichenden Verhaltens‹, der es darum geht, Fälle zu untersuchen, die nicht in ein gesetzmässig formuliertes Schema passen (vgl. dazu die ›Deviant Case Analysis‹ im symbolischen Interaktionismus). Da Einzelschicksale aber mehr darstellen können als Ausnahmen von der Regel, haben Forscher sie immer wieder auch herangezogen, um ein beobachtetes Phänomen zu illustrieren und es besser verstehen zu lernen. Fallstudien, wie sie in der klinischen Psychologie selbstverständlich sind, haben auf diese Weise auch in die statistisch orientierte Forschungspraxis stärker Eingang gefunden.
56
Die Studie von 1933 ist ein Beispiel dafür. Das erklärte Ziel war es zwar, über die Dorfgemeinschaft ›objektivformulierbare‹ Aussagen zu gewinnen und ›Details … als Ausdruck einer möglichst kleinen Zahl von Haupttatsachen zu sehen‹ (1975, S. 24). Dazu aber bedienten sich die Autoren auch der Impressionen, Familienschicksale und Fallgespräche, die sie für die Untersuchung verarbeiteten. ›Einfühlende Beschreibung‹ nannte Lazarsfeld sie rückblickend in seinem Vorwort 1960 und fügte hinzu:
»Es ist im Auge zu halten, dass objektives ebenso wie subjektives Material sowohl statistisch wie ›klinisch‹ behandelt werden kann.«
(1975, S. 15).
Es ging uns in unserer Untersuchung darum, aus den individuellen Erzählungen ebenso zu lernen, wie aus den verobjektivierten Zahlen. Schon der Zugang zur Dorfgemeinde führte ja über Unterhaltungen, zufällige Eindrücke und sich langsam verfestigende Bilder. Die Einbeziehung von Fallstudien und qualitativen Interviews in die Arbeit macht das subjektive Moment nur explizit.
In zwei Fallstudien wollen wir Situationen aus dem ›alten‹ und dem ›neuen‹ Marienthal bzw. verschiedene Formen von Lebensbewältigung darstellen. Das eine Beispiel ergab sich, als wir erkannten, dass wir es mit der ›Fortsetzung‹ einer 1933 beschriebenen Familie zu tun hatten. Die zweite Fallstudie illustriert eine für Marienthal untypische Situation. Der abweichende Fall soll aber nicht gegen eine Regel abgesetzt werden, sondern vielmehr bestimmte soziale Probleme der heutigen Gemeinde deutlicher machen.
57
4.8.1. Die Brüder K.
»Frau J.K., geboren 1890 in Erlach bei Pitten. Der Vater war eifrig in der Sozialdemokratischen Partei tätig und musste deshalb ununterbrochen seinen Arbeitsplatz wechseln… Sie landeten dann in Marienthal, wo die politischen Verhältnisse ziemlich günstig waren. … Sie kam in die Fabrik als Laufmädel und arbeitete bis 1914 in der Fabrik. 1910 heiratete sie. … Der Mann rückte ein und fiel im Jahre 1917. Damals waren die Kinder eineinhalb Jahre, drei Jahre und sieben Jahre alt. … Der Älteste ist (1932) Gärtner in Marchegg und verdient 44 Schilling die Woche, der kann ihr nichts geben, weil er auf ein Motorrad spart, aber der zweite ist in Wien beschäftigt und verdient 40 Schilling in der Woche, ausserdem bekommt er alle Hemden vom Betrieb. Er gibt ihr 30 Schilling in der Woche. Den Jüngsten hat sie noch zu erhalten. … Nach dem Krieg begann sie aktiv in der Sozialdemokratischen Bewegung zu arbeiten, war erst in der Frauenorganisation, dann in der Kinderfreunde-Bewegung tätig. Sie ist im Ausschuss der Kinderfreunde… Ihre beste Zeit ist jetzt, weil sie nun sieht, dass aus ihren Kindern etwas geworden ist.«
(aus der Studie, 1933, S. 108f.)
Aus den Kindern wurde noch einiges mehr seither. Jeder der drei Söhne repräsentiert eine Möglichkeit, mit den Problemen in Marienthal fertig zu werden. Gemeinsam waren und blieben ihnen die Verankerung in der sozialdemokratischen Bewegung und eine geografische Verbundenheit mit Marienthal: Aus der Gegend wegzuziehen, stand für sie nicht zur Debatte, auch nachdem sie die Mutter besser versorgt wussten. Die individuelle Bewältigung ihrer Lebenssituation war schon in der Studie 1933 vorgezeichnet.
Der eine Sohn, J.K., konnte der Gärtnerei zwar nicht in Marienthal selbst nachgehen, blieb aber erst in der Nähe. Nach Aufenthalten in Marchegg und in der Schoeller-Villa bei Puchberg heiratete er ein Mädchen aus Wienerherberg und erwarb dort schliesslich seine eigene Gärtnerei. Er war,
58
wie sich auch die Brüder erinnern, immer schon der ›Selbermacher‹. Seine Beziehung zur Tradition, in der er aufwuchs, beschränkte sich auf Mitgliedschaft in der Partei und Sympathie. Im Laufe der Jahre war ihm die Gärtner- und Werkarbeit wichtiger geworden. In den letzten Jahren allerdings war er durch eine Verwandtschaft wieder enger mit dem Schicksal Marienthals verbunden: Seine Tochter hatte den Architekten [d.i. Josef Hums; Anm. R.M.] geheiratet, der die Revitalisierung der Siedlungshäuser plante.
Der zweite Bruder, L.K., war beim Firmenzusammenbruch knapp vierzehn, ab dem Zeitpunkt suchte und fand er Arbeit in Marienthal und Umgebung, auch in Wien, schliesslich bei der Firma Sonnenschein, die das Fabriksgebäude übernommen hatte. Er war der politisch aktivste der Brüder.
»Im Ständestaat war ich immer politisch ›unzuverlässig‹, ich hab eine Arbeit nur ein paar Wochen gehabt, dann war ich ihnen wieder zu unzuverlässig.«
Es waren vor allem die Versuche politischer Arbeit nach 1934, die er teuer zahlen musste:
»Ich bin auch geschlagen worden von der Polizei, ich war immer dran, da war z.B. die 1.-Mai-Geschichte auf dem Teich, da haben sie einen Gehenkten als Puppe auf ein Boot gestellt mit dem Schild, ›Dem Volke‹, so, dass man das Boot nicht gleich hat holen können. Und auf einem Dach stand in Rot: ›Es lebe die Internationale‹. Das haben sie wegmachen müssen und da haben sie es eben schwarz angestrichen, da konnte man es genausogut lesen… Aber jetzt gehen wir nicht mehr auf die Dächer.«
Über die Illegalen:
»Der Turnverein war die Keimzelle des Nationalsozialismus in Gramatneusiedl. Man hat nicht so richtig rausbekommen, dass das Judenhasser waren. Bis zum
59
Einmarsch vom [Adolf] Hitler gab es das nicht. Aber in Wirklichkeit hat es mehr Kollaboration mit den Nazis gegeben, als wir erwartet hatten. Ich selber war eh nicht ›würdig‹, bei der SA aufgenommen zu werden… Aber der Ständestaat war schon keine Demokratie mehr. Da waren wir schon voller Angst.«
Auch die Frau von L.K. war schon in den zwanziger Jahren aktiv in der Bewegung. Sie spielte in der Marienthaler Schauspielgruppe und organisierte Veranstaltungen für die Kinderfreunde und die Jugendgruppe. »Ich war aber keine Funktionärin.« Nach 1929 kam sie bei verschiedenen Betrieben unter, im Dritten Reich wurde sie dienstverpflichtet, zum Teil bis nach Wiener Neustadt.
1938, als L.K. bei Sonnenschein arbeitete und die Fabrik ›arisiert‹ wurde, musste er seinen Posten verlassen,
»und die Nazibuben sind hineingekommen auf unsere Posten, obwohl sie nichts von der Arbeit verstanden haben. …am Anfang waren wir ja froh gewesen, dass wir Arbeit und Aufträge gekriegt haben, wie jeder in Österreich. Nur reden hat man halt nicht dürfen.«
Er war wie seine beiden Brüder im Krieg. Mit einer Kopfverletzung kam er 1944 zurück und musste fortan Militärfahrzeuge nach Mauthausen fahren, »denn die KZs wurden nicht bombardiert«. Dort erkannte er einen Marienthaler unter den Aufsehern.
Ȇberhaupt hat es viel mehr Kollaboration mit den Nazis gegeben als wir vermutet hatten.
Nach dem Krieg gehörte die Firma wieder dem Sonnenschein, aber wir haben ihn nie zu sehen bekommen.«
L.K. wurde Betriebsobmann der kleinen Weberei.
»Wir haben ihm dann 1949 geschrieben, ob er sich interessieren tät, worauf er einen Treuhänder eingesetzt hat. Also der Jud' – ich sag es nicht abfällig –
60
den hab ich dann am Wörthersee abgeholt, wo er im teuersten Hotel mit dem Buben und der Frau Gemahlin gewohnt hat. ›Guten Tag, Herr K.‹, hat er gesagt, ›Sie waren unter den letzten, die noch zu uns gehalten haben.‹ Dann hatten wir eine Sitzung, wo ich die Forderungen für die Firma gestellt habe. Und da hat er gesagt: ›Was glauben Sie, was das kostet? Über eine Million!‹ Aber dann haben wir gesagt, ›Die Zeiten sind vorbei, wo ein Arbeiter vom Stockerl fällt, wenn er eine Million hört, Herr Sonnenschein!‹ Nein, ›Herr Kurt‹ hab ich gesagt. Die Zeiten sind auch vorbei, wo man die Leute am Freitag kündigt, weil es sonst Urlaub geben würde, und dann stellt man sie nach vier Tagen wieder ein, und die Urlaubsrechte sind erloschen. Da hat der Herr Sonnenschein kein Interesse mehr gehabt und die Firma an den Karoly [recte Justinian Karolyi; Anm. R.M.] verkauft.«
In den fünfziger und sechziger Jahren war L.K. im Gemeinderat, mehrere Jahre war er Vizebürgermeister und für kurze Zeit auch Bürgermeister. In seiner Amtszeit fanden auch die Verhandlungen mit den Österreichischen Chemischen Werken um die Werksniederlassung statt.
»Die beiden Direktoren wollten etwas draus machen. Na, fangen wir an, wir werden ca. 400 Leute brauchen. Das war damals Zucker! Uns war das wurscht, wo die Firma herkommt, Hauptsache, es fängt wieder an. Das war die Degussa, viertgrösster Konzern von Deutschland, und der Dr. G., der Direktor, der war ein typischer Deutscher. Bei dem hat der Mensch erst beim Doktor angefangen… Dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, ›Na, L., jetzt kannst im Geld herumrühren!‹ – ›Das bekomm ja nicht ich, Herr Doktor,‹ hab ich gesagt, ›das bekommt der Fiskus.‹«
Seit Ende der fünfziger Jahre wohnen L.K. und seine Frau in einem der Gemeindebauten. In seiner Arbeit im Pensionistenverband setzt er sich dafür ein, dass Geld für die Renovierung von alten Wohnungen wie denen in Marienthal bereitgestellt wird statt für den Bau neuer Pensionistenheime,
61
»weil der alte Arbeiter nicht gern von seiner Wohnung weggeht in ein Heim. Er möcht halt nur nicht gern über die Gasse um ein Wasser und über den Hof aufs Klo… Es kennt jeder seinen Nachbarn, wenn man in so einer kleinen Gemeinde ist. Ich glaube nicht, dass meine Frau, wenn sie allein wäre, nach Himberg (ins Pensionistenheim) gehen möchte.«
Die K.s haben Aufstieg von der Hinterbrühl geschafft und sind doch gleichzeitig dem Ort verbunden geblieben. Arbeit bedeutet für sie den Schlüssel zu diesem Aufstieg, Arbeitslosigkeit hingegen das Trauma, das sie mit ihren schlimmsten Jahren identifizieren.
»Ich sag immer, eine Katastrophe möcht's geben, wenn es keine Arbeit gibt oder Stagnation, da gibt's Mord und Totschlag, und das kann über Nacht wieder kommen.«
Mit ihrem persönlichen Schicksal scheinen Sie zufrieden? »Dem Alter entsprechend; so gut ist es uns noch nie gegangen.« Für L.K. der sich noch an den Klassencharakter des Herrenparks erinnern kann, bedeuten die Möglichkeiten, die seine Frau und er heute ausschöpfen können, eine persönliche und politische Genugtuung: »Früher hätte sich doch ein Arbeiter doch ein Lebtag nicht denken können, dass er einmal an den Lago Maggiore kommt.«
W.K. ist der jüngste der drei Brüder. »Ich habe die Hosen von meinen Brüdern getragen und da gab es Kinder, die meine Hosen auch noch getragen haben.«. Bereits in der Schule erlebte er die Trennung zwischen den Gramatneusiedler Bauern und den Marienthaler ›böhmischen‹ Arbeitern, die sich nach 1929 zuspitzte:
»Der Pfarrer ist von einem Bauern zum anderen essen gegangen und hat natürlich die Sprösslinge auch bevorzugt. Wir waren immer die Gauner und Verbrecher… Der Oberlehrer war konträr. Wenn er einen Bauernsohn gehabt hat, da hat er gesagt, der dümmste Bauer erntet die grössten Kartoffeln, kannst ruhig blöd bleiben. Von der untersten Schicht muss man sich selber helfen.«
62
Zu Beginn der dreissiger Jahre fand er durch Zufall Arbeit: »Ich hab eine Lehre angefangen, weil der S. einen Zettel gesehen hat: Lehrling wird aufgenommen.« In diese Zeit fiel auch seine politische Bewusstwerdung. Bis dahin wuchs er selbstverständlich in den Sozialdemokratischen Kinder- und Jugendorganisationen auf.
»Plötzlich, im vierunddreissiger Jahr, wurde der Arbeitersportverein aufgelöst, wir waren plötzlich ›Politiker‹, obwohl wir uns nie darum gekümmert haben. Damals sind wir eigentlich erst hellhörig geworden… Und März '38, da hab ich gerade in Wien gearbeitet, und wir hören die Verlautbarung im Radio, wie der [Kurt] Schuschnigg sagt: Gott schütze Österreich. Ich habe zu meiner Mutter gesagt: Das ist der Krieg. Viele waren froh, wegen der Gulaschkanonen: ›der Kurt ist furt, jetzt geht's uns guat‹. Ja, der Kurt ist furt, das ist richtig, aber ich hab gewusst, dass nichts Besseres nachkommt. Diktatur ist Diktatur.«
1939 heiratet W.K. Die Familie (zwei Kinder) überstand die Kriegsgeschehnisse und die Nachkriegszeit schlecht und recht. Das zweite Kind entband Frau K. 1945 ohne Hebamme, eine Woche, nachdem ihr Mann aus der amerikanischen Internierung nach Marienthal zurückgekehrt war. Um aus der alten Wohnung in der Hinterbrühl wegzukommen, hatte sich die Familie K. 1939 einen Grund etwas ausserhalb von Marienthal gekauft und sich ein provisorisches Hütterl gebaut.
»Die Frau hat da eine Gass' und die Hendln und fünfzig Hasen eingesperrt gehabt. Wie die Russen gekommen sind, haben sie die Hasen nicht gegessen; die haben sie nur alle rausgelassen.«
Ab 1945 engagierte sich W.K. hauptsächlich für den Siedlerverein, der die Genossenschaft bei Marienthal vertrat.
»Dadurch bin ich überhaupt erst wieder politisch aktiv geworden. Ich war seither in der Partei und von 46 bis 48 auch im Gemeinderat.«
63
Durch die Arbeit bei der Gemeinde und durch seine Brüder erfuhr er Vieles über die Vorkommnisse in Marienthal seit seiner Einberufung. Er bedauert, dass nicht mehr gegen die Verkäufe und den Verfall der ehemaligen Fabrikseinrichtungen getan wurde.
»Das war ja eine der mustergültigsten Siedlungen überhaupt, aber die Kanalisation, der Teich, der Park: Alles ist durch diese privaten Verschacherungen ruiniert worden. Dabei war das doch die Todesko-Stiftung, das hätte ja garnicht verkauft werden dürfen. Natürlich haben wir dann alles versucht, wir waren sogar beim Justizminister und haben gesagt, das kann doch nicht sein! Aber es war so.«
Im Gemeinderat bemühte er sich um eine Neuregelung und Minderung des Zinses für die Altbauten.
»Es sollte ein bisserl eine Linderung geben. Es gab ja viele Arbeitslose, auch nach dem Krieg.«
Eigentlich wollte er mit seinem Schwager eine Werkstatt aufmachen, »der ist aber nie zurückgekommen.« Für seinen Bruder arbeitete er in der Gärtnerei, bei den Bauern drosch er Getreide. 1948 bis 1976 war er bei Mautner-Markhof in Wien, zum Schluss als Werkmeister einer Fabrikanlage. Er war Wochenendpendler. In den sechziger Jahren baute die Familie das einstöckige Siedlungshaus, in dem sie jetzt wohnen.
Die praktische Lösbarkeit von Problemen ist für ihn zur Maxime geworden, sei es im kleinen in Haushaltsdingen, sei es in Fragen wie Atomkraft oder industrieller Produktivität.
»Ich bin für die Firma viel herumgekommen. Ich war z.B. in Schottland und England, bei denen ist der Maschinenpark eine Katastrophe. Aber deswegen sind wir konkurrenzfähig, weil man uns nach '45 alles weggenommen hat und wir haben neu anfangen müssen.«
64
Wenn wir die Familien der Brüder K. besuchten, bleiben die Frauen zunächst im Hintergrund und delegierten Antworten oft an ihre Ehemänner. Wir sahen aber, dass sie durchaus ihren Anteil an Entscheidungen hatten, wahrscheinlich immer schon gehabt hatten; dass sie die Geschicke der Familien mitbestimmten, die beiden Familien, die im Ort geblieben sind, zählen zu den prominenten Marienthalern, die auf keiner grösseren Veranstaltung fehlen.
Auch ihre Verwandten der nächsten beiden Generationen sind in der Gemeinde fest verankert. Sie haben bei der Para-Chemie Arbeit gefunden, neue Wohnungen bezogen, Häuser gebaut. J.K. »hat immer eine grosse Eignung bewiesen, sich ihr Leben gut einzurichten«. Ihre Fähigkeit scheint auf die Söhne und Enkel, den veränderten Umständen in Marienthal entsprechend, übergegangen zu sein.
4.8.2. Die Familie L.
In den Zeiten der Textilfabrik waren es die böhmischen Arbeiter, die das Gros der Belegschaft stellten und die mit den alteingesessenen Gramatneusiedlern, aber auch mit den österreichischen Arbeitern manchmal in Konflikt gerieten. Die Auseinandersetzungen verschärften sich nach dem Firmenzusammenbruch und nahmen einen deutlichen Klassencharakter an, wurden aber durchaus auch entlang ethnischer Linien geführt.
Die ›Marienthaler Bemm‹ haben sich im grossen und ganzen assimiliert, ähnlich vielleicht wie die vielen Tschechen in Wien, und sind meistens nur noch an ihren Namen erkennbar. Dafür zogen durch die Expansion der Para-Chemie die jugoslawischen Gastarbeiter in Marienthal zu, wiederum ist Marienthal kein Einzelfall: auch die Industrien und
65
Gewerbe vieler Nachbarorte beschäftigen ausländische Arbeitskräfte, und auch die auftretenden Probleme sind dem Anschein nach ähnliche. In der Familie L. sind sie quasi auf einen Nenner gebracht, vorhanden.
V.L. kommt aus Kroatien. Sie war eines von vier Kindern, für eine Ausbildung reichte es nicht. Auswanderung bzw. Gastarbeit in Westeuropa waren die Auswege: Ein Bruder und ihre Mutter leben heute auch in Österreich, eine Schwester in der BRD, ein Onkel in Australien. Sie selbst kam 1968 als sechzehnjährige nach Götzendorf zur Arbeit. Nach eineinhalb Jahren wechselte sie in einen Betrieb bei Marienthal, da lernte sie ihren jetzigen Mann kennen, F.L. einen ungelernten Arbeiter. 1972 heirateten sie. Sie hatten damals zwei Kinder und seither zwei weitere.
Sie wohnen zu sechst in einer Zweizimmer-Wohnung im ›Altgebäude‹, einem ehemaligen Kloster- und Betriebshaus, gegenüber der Fabrik, das so alt ist, dass die Gemeinde eine Renovierung für nicht mehr durchführbar hält. Der Vorraum dient gleichzeitig als Bad. Das Schlafzimmer der Eltern, ein Durchgangszimmer, ist zugleich Fernsehraum (vor allem für die Kinder, wenn sie aus der Küche geschickt werden) und der Platz für die Wiege der neugeborenen Tochter. Die Toilette liegt auf dem Gang und wird von den jugoslawischen Nachbarn mitbenutzt. Sie arbeiten alle in der Para-Chemie und kommen oft und selbstverständlich zu L.s auf Besuch. Die Küche ist der Hauptaufenthaltsraum, es wird dauernd etwas Wohlriechendes gekocht. Die Atmosphäre ist durch die emsige Haushaltstätigkeit von V. bestimmt. Die Wohnung ist verhältnismässig teuer eingerichtet. Man merkt, dass bewusst investiert wurde. F. hat die Wände tapeziert und Spannteppiche gelegt. An einer Seite ein überdimensionierter Wandschrank mit Vitrine, eine Mischung aus jugoslawischer Folklore und
66
österreichischem Mittelstandsdenken. Einige Bücher, wahrscheinlich aus einem Buchklub, [Mario] Puzo, [Johannes Mario] Simmel u.a.; alte Familienbilder, ein Hochzeitsfoto von F. und V. im Mittelpunkt des Blickfeldes; Souvenirs von Verwandten aus Australien.
Man hat das Gefühl, dass sie um eine Spur über ihre Verhältnisse leben. Tatsächlich beschwert sich V. häufig der Geldnöte. Kredite müssen zurückgezahlt werden, das Auto ist ein Problem, die Schule der älteren drei Kinder kostet. Jeder Schilling muss eingeteilt werden. V. schaut, dass gespart wird, wo es nur geht. Zigaretten werden in Ungarn gekauft.
»Auch Nüsse sind dort billiger und ich fahr eh durch, wenn ich nach Jugoslawien fahr.«
Nur selten hat sie neben den Kindern und Haushalt Zeit, eine (schlecht bezahlte) Heimarbeit durchzuführen, wie das Frauen in der Gegend häufig tun. F. arbeitet seit kurzem bei der Para-Chemie in der Schicht.
Die Heirat wurde von den Verwandten F.s nicht gern gesehen.
»Ich war ja ein Tschusch, eine Ausländerin, alles mögliche Schlechte… Heute bin ich (für sie) die Beste … aber damals, wie ich Hilfe gebraucht hab, hat mir niemand wollen helfen.«
Während es V. zunächst nicht gelang, Freunde zu gewinnen, verlor F. die wenigen, die er hatte. Dass er viel trank, dürfte sowohl Folge als auch Mitursache dieser Isolierung sein. Einige Marienthaler meinen, dass er immer schon ein ›schwieriger‹ Mensch gewesen sei.
»Ich hab nurmehr jugoslawische Freunde seither«,
67
sagt F., »aber das ist auch schwer, weil ich verstehe ja nicht alles«. Seine Frau widerspricht ihm: »Du willst nicht verstehen.« »Nein, dann kommen ihre Freundinnen und die reden miteinander, na, dann trink ich halt noch mehr.« In der jugoslawischen Gemeinschaft ist er jedenfalls eher daheim als bei seinen Landsleuten. Er ist oft der einzige Österreicher auf jugoslawischen Festen und spricht deutsch bereits mit einer leicht kroatischen Färbung. Immer noch erlebt auch V. Diskriminierendes. Es kann plötzlich kommen, auf dem Hof wegen der lauten Kinder, auf der Strasse als Provokation.
»Früher ist ein Kind an mir vorbeigegangen, hat es gelacht und hat gesagt, schau die Tschuschen an. Ich hab ja alles verstanden, aber was hab ich können unternehmen? Ja überhaupt nix. Heute sag ich zu jedem meine Meinung, da traut sich keiner so schnell was sagen … ich glaube, viele Österreicher sind eifersüchtig auf die jugoslawischen Leute, weil die arbeiten und sparen und halten mehr zusammen.«
Wir fragen V., ob sie nicht lieber nach Jugoslawien zurückkehren würde.
»Früher hab ich solche Heimweh gehabt, ich habe geweint. Aber jetzt ist es mir egal, ob ich da oder da bin. Sogar bin ich lieber da, wegen der besseren Lebensart, alles mögliche ist besser wie bei uns unten.«
Die drei Kinder, die in die Schule gehen, sprechen beide Sprachen.
»Früher haben meine Kinder nicht können jugoslawisch reden, nur verstehen, aber jetzt fahren wir alle Winter- und Sommerferien hinunter, da lernen sie, auch die anderen Sitten und Musik.«
Dass ihre Sprecherfahrung im deutschen von zu Hause aus eher beschränkt ist, dürfte der Grund dafür sein, dass die älteste Tochter, die dreizehnjährige D., in den B-Zug der Hauptschule eingeschult worden ist.
68
D. schneidet in der Schule mittelmässig ab, was nicht weiter verwunderlich ist, da sie zu Hause mit dem Baby, mit Einkaufen und anderen Haushaltstätigkeiten voll beschäftigt ist. Von den Eltern bekommt sie kaum Unterstützung, was das Lernen angeht. »Wie soll ich ihr sagen, ob man das oder jenes schreibt mit scharfem S oder was weiss ich«, klagt V., und F. hat oft keine Geduld, sich nach der Arbeit mit ihr zusammenzusetzen, selbst wenn die Schicht es ihm gerade erlaubt. »Sie soll selbständig werden«, meint er monoton zu dem Problem.
Wir machten einmal Assoziationstests mit einigen Marienthaler Kindern und liessen sie zu Reizwörtern spontan passende Wörter finden. Auf das Wort ›Familie‹ reagiert D. zögernd mit ›Heimat‹. Dieser ganze Komplex ist gerade für sie ungeklärt. Zweisprachig in einer oft verständnislosen Umwelt, fühlt sie sich in der halbjugoslawischen Familie geborgen, möchte aber auch mit der Marienthaler Umwelt in der Schule, im Hinterhof usw. ›normal‹ zurechtkommen.
Einige Ortsbewohner wunderten sich, dass wir die L.s in unsere Videodokumentation aufnahmen. »Der F. ist ja kein typischer Marienthaler.« Typisch scheinen uns aber die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn die Beziehungen zwischen Jugoslawen und Österreichern über lockere Arbeits- und Sozialkontakte hinausgehen. Dass die L.s die Situation bisher bewältigten, lässt hoffen, es fragt sich aber, wie es (Ehe)partnern ergeht, die einen weniger starken Willen als V. haben.
Einige Monate nach unserer Untersuchung zogen die L.s aus dem Altgebäude in eine grössere Wohnung in der neuen Genossenschaftssiedlung hinter dem Fabriksgelände – ein erster Schritt in der Marienthaler Hierarchie des Aufstiegs.
69
5. Exkurse
5.1. »Der Jud'«
Bei der Rekonstruktion der Geschichte Marienthals und seiner Fabrik fiel uns wiederholt die Rolle auf, die Juden im Gemeindeleben, mehr aber noch in der Vorstellung der Bewohner hatten. Es ist kaum möglich, eine sozialpsychologische Bestandaufnahme eines Ortes wie Marienthal zu machen, ohne auf tradierte Stereotype von »dem Juden« zu stossen, auch wenn seit über vierzig Jahren kaum jemand einen zu Gesicht bekommen hat. Die rede von ›Antisemitismus ohne Juden‹ bewahrheitet sich allenthalben in mehr oder minder subtilen Nuancen, so auch in dieser Industriegemeinde. Wenn wir unsere Beobachtungen in Marienthal schildern, dann mit der durch viele Untersuchungen gestützten Vermutung, dass die Problematik anderswo noch viel deutlicher auftritt.
»Der Jud‹« begegnete uns in vielen Gesprächen mit älteren Bewohnern, manchmal mit erklärenden Zusätzen wie »so haben wir ihn immer genannt«, oder »aber ein netter Jud', muss ich sagen«. Gemeint waren damit verschiedene Leute: Der Unternehmer Sonnenschein oder sein Sohn, deren Nachfolger Karoly [recte Justinian Karolyi; Anm. R.M.], vor allem aber der frühere Fabriksdirektor [Leopold] Specht (bis 1928 [recte 1927; Anm. R.M.]). Wenn wir nachfragten, hatten wir häufig den Eindruck, dass sich unsere Gesprächspartner nichts anderes dabei dachten, als dass er eben als Jude ausreichend charakterisiert sei: Jemand, der viel Geld verdiente und, so könnte man hinzufügen, nicht aus Marienthal kam: Ein Fremder zumindest im Bewusstsein der Ortsansässigen. Es gab allerdings auch eine ortsansässige jüdische Familie, die eines Tages abtransportiert wurde: Niemand scheint zu wissen, wohin, man erinnert sich kaum an sie oder an die ›Damen Marx‹, die einmal erwähnt wurden.
70
Die Erzählungen über sie sind knapp und farblos im Vergleich etwa zu den Schilderungen über den Einmarsch der Russen. Im Gegensatz zu dieser kollektiv erlebten Episode in der Geschichte des Ortes ist die vermutliche Liquidierung der einzigen jüdischen Familie ein unangenehmes Indiz für die Kenntlichkeit der Nazi-Barbarei.
Andererseits wäre hier zu sagen, dass es in Marienthal zu spontanen Äusserungen der Sympathie mit den Naziopfern kam. So erzählte uns eine über achtzigjährige Frau, wie sie und andere Bewohner einem Tross deportierter Juden helfen wollten, die gegen Kriegsende durch Marienthal getrieben wurden. Soldaten hinderten die Marienthaler daran, ihnen Trinkwasser zu geben. Aus Episoden wie dieser lässt sich schliessen, dass gedankenlos geäusserte diskriminierende Bezeichnungen, wie sie in Marienthal vorkamen und noch immer vorkommen, nicht mit offenem Antisemitismus gleichzusetzen sind. Nur sind die Grenzen schwer zu ziehen und vor allem für die Diskriminierten selbst nicht unbedingt zu erkennen.
Man kann aus der Geschichte der Monarchie bzw. der Zwischenkriegszeit ersehen, dass das Thema Jude / Antisemitismus auch in Marienthal eine bedeutende Rolle gespielt haben muss. Dazu könnte auch eine Polarisierung entlang der Klassenschranken stattgefunden haben: Hier die Arbeiter, teils tschechischer Herkunft, katholischer Hintergrund, eventuell freidenkerische sozialdemokratische Ideologie, dort die Firmenleitung, früher der jüdische Wiener Bankier Todesko, ab 1925 ein Konzern unter der Leitung von Isaak Mauthner [recte Isidor Mautner; Anm. R.M.], dazu der Fabriksdirektor [Leopold] Specht. Umso erstaunlicher, dass das Problem in der alten Studie nicht einmal angeschnitten wurde. Lediglich auf Seite 30 heisst es:
»… der ›Ratenjud‹, wie man den Wiener Hausierer nennt«;
71
es klingt hier eine leichte Distanzierung zu dem Ausdruck an: Der Hausierer, ob er nun Jude war oder nicht, sollte eigentlich in erster Linie als Wiener definiert werden.
Die selber jüdischen, agnostisch erzogenen Autoren der Untersuchung (vgl. z.B. Jahoda, in Greffrath, 1979, S. 110f.) sind möglicherweise einem Wunschdenken aufgesessen: dass nämlich die Dimension des Antisemitismus bzw. überhaupt das Denken in Kategorien von Rasse oder Religionszugehörigkeit nicht relevant sei bei der Untersuchung von politischen und psychologischen Auswirkungen einer Wirtschaftsdepression. Wie unrecht sie hatten, sollte sich bald katastrophal erweisen. Aber auch schon damals war das Problem sogar innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung, zu der die Autoren gehörten, in seiner Tragweite zu erkennen. Dass Antisemitismus ein tragendes Element der austrofaschistischen und deutschnationalen Agitation war, ist bekannt (vgl. z.B. Stuhlpfarrer, 1977). Marie Jahoda erinnerte sich aber auch an die latente, manchmal auch recht offene Judenfeindlichkeit der SP-Basis in der Zwischenkriegszeit: 1933 wurde Paul Lazarsfeld bei einem sozialistischen Jugendtreffen von Nazi-Jugendlichen geschlagen.
»Es war eine so böse Angelegenheit, weil es ein klarer Fall von Antisemitismus war, der nicht von allen Sozialisten so zurückgestossen wurde, wie man es sich hätte wünschen mögen… Die Erfahrung, dass es unter uns welche gab, denen das nicht so schrecklich vorkam, war ein ernstes Erwachen über die Kräfte, die am Werk waren und die wir nicht genügend verstanden haben.«
(Greffrath, 1979, S. 110f.)
Belege für Antisemitismus innerhalb der Partei gibt es u.a. auch von Parteitagen, in offiziellen Reden und in Artikeln der ›Arbeiter-Zeitung‹ (siehe dazu auch Spira, 1981). Eine beliebte konservative, von manchen Sozialdemokraten übernommene theoretische Figur war der reiche,
72
womöglich noch galizische ›Bankjud'‹, der der eigentliche Nutzniesser aller Krisen sei: Dass so eine Argumentation auch im Marienthal des Firmenbankrotts auf fruchtbaren Boden fallen konnte, ist nicht auszuschliessen, bedenkt man noch dazu die traditionell ›rechte‹ sozialdemokratische Basis in Niederösterreich, in der beispielsweise der intellektuelle jüdische Parteiführer Otto Bauer gegen Karl Renner keine Chance hatte (vgl. Ritschel, zitiert in Spira, 1981, S. 55f.) Es ist schwer zu rekonstruieren, welche Einflüsse in Marienthal tatsächlich wirksam waren. Otto Bauer z.B. war ein beliebter Redner in Marienthal, und die Industriegemeinde hatte ein aufgeklärtes und um Bildung bemühtes Kulturleben entwickelt. Andererseits waren die Konzernleitung und der ›Jud'‹ [Leopold] Specht (im Buch lediglich als der »neue Direktor, der jahrzehntelang in Marienthal herrschte«, beschrieben) Zielscheiben politischer Agitation, die durchaus im ›völkischen‹ Sinn ausgebeutet werden konnten.
Dem Forscherteam jedenfalls scheint nichts Gravierendes aufgefallen zu sein, das ihren Blick für offensichtliche Schwachstellen sozialdemokratischer Praxis auch in Marienthal geschärft hätte.
»Nach all dem kann man nicht Nichtjude sein«, sagt Marie Jahoda rückblickend. Der Satz sollte sich in Marienthal nach fünfzig Jahren wieder bewahrheiten und sie daran erinnern, warum sie seit so vielen Jahren in der Emigration lebt. Eine Frau, mit der sie sich bei unserem Besuch in der Gemeinde unterhielt, erzählte ihr freundlich und es sozusagen ›gut meinend‹ von einem Juden, mit dem sie einmal zu tun hatte: »Aber er war ein netter Mensch.«
M.F. [d.i. Michael Freund; Anm. R.M.]
73
5.2. Selbstverständigungstext
Im Laufe unserer Arbeit schrieben wir öfters interne Texte, die halb als Gedächtnisprotokolle, halb als Anregung für weitere Fragen dienten. Die Interpretation der Marienthaler Realität durch unsere von aussen bestimmte Sichtweise und die Versuche, diese Äusserlichkeiten zu überwinden, sollten in ihnen aufgezeichnet werden. Als Beispiel geben wir im folgenden die leicht gekürzte Fassung eines Textes wieder, der zwei Monate nach Beginn der Studie entstand.
Rundgang durch und um Marienthal: In den kasernenähnlichen, an Vorläufer heutiger Wohnblocks erinnernden Altbauten ist nur minimaler Raum zum Wohnen vorhanden. Das architektonische Grundmuster zweier Räume, Wohnküche und Wohnschlafzimmer, früher auch für eine mehrköpfige Familie gedacht, ist zwar erhalten geblieben. Familien mit mehreren Kindern haben aber im allgemeinen zwei nebeneinander liegende Wohnungen mit Durchbruch, so dass Schlafzimmer für die Kinder dabei herausspringen. Die Enge drängt trotzdem das Leben nach aussen. Nahezu vor allen Türen ist noch ein kleines Stück Hof als zusätzlicher Wohnraum mit Zaun abgegrenzt, hergerichtet als ein Zwischending von Garten und Zimmer: überdachter Balkon, Wintergarten, öffentliche Hausdiele. Die Schuhe werden dort abgestellt, es gibt Teppichstücke, kleine Schränke, Bilder, Pflanzen, Blumen. Bei schönem Wetter herrscht ein fast südländischer Lebensstil, Stühle werden herausgestellt, Hausfrauenarbeiten draussen verrichtet; die Jugoslawen spielen Brettspiele, man plaudert miteinander.
Es wäre zu untersuchen, inwieweit sich die existierenden Kommunikationsmöglichkeiten in positiven Formen einer Nachbarschaftshilfe niederschlagen, z.B. in direkte prak-
74
tische Hilfe beim Kinderüberwachen, Ausleihen von Gegenständen u.ä. – also Möglichkeiten von Widerstand gegenüber institutionellen Zwängen. Ich nehme aber an, dass das eher meine Wunschvorstellungen sind, vor allem was die österreichischen Bewohner und unter ihnen die alten Frauen anbelangt; bei den Jugoslawen spüre ich so eine Gemeinschaft schon eher.
Beobachtet habe ich bisher eher die Schattenseite der räumlichen Nähe: die Einschränkung und Kontrolle der Lebensäusserungen. Beispiel: Eine alte Frau, die hinten bei uns auf dem Balkon (Pawlatschen) im Hinterhof wohnt, lächelt einerseits unserer Nachbarin, der Frau G., freundlich ins Gesicht, zieht hinter ihrem Rücken aber über sie her. Sie brüstet sich auch damit, die Jugoslawen, die seit Jahren direkt neben ihr wohnen, zur ›Schuhordnung‹ erzogen zu haben und besonders den ›Weibern, die so ein grosses Maul haben, es gestopft zu haben.‹
Interessant wäre herauszufinden, ob und in welcher Weise sich der Widerspruch zwischen der Toilette als heute vollständig dem Intimbereich zugeschlagener Ort und ihrer offensichtlichen Öffentlichkeit hier in Marienthal niederschlägt; desgleichen der Widerspruch zwischen unserem körpergeruchssterilen, mit Waschwerbung überdeckten hygienischen Zeitalter und der Eindeutigkeit der Gerüche in Marienthal. Leiden die Leute darunter? Oder hat sich bei ihnen durch die Gewohnheit eine andere Wahrnehmungsstruktur entwickelt? Was denkt einer, der z.B. bei strömendem Regen oder im eiskalten Winter hinaus muss? Das Waschhaus, wo noch mit Holz geheizt und mit Brunnenwasser geschwemmt wird: Organisieren die Frauen untereinander die Benutzung? Was reden sie, wenn sie gemeinsam drin sind? Welche Auswirkungen hat das für ihr sonstiges Verhalten zueinander? Bedeutet es für sie eventuell, ihre Isolation als Frauen
75
zu durchbrechen und zu sehen, dass andere Frauen ähnliche Probleme haben? (Vergleich auch Österreicherinnen – Jugoslawinnen; Vergleich mit unseren Frankfurter Stadtteilkonzepten, als wir für die Ausländerfrauen einen Waschsalon einrichten wollten). Welche Gefühle haben sie, wenn sie täglich in der Hauptstrasse an einem Elektrogeschäft vorbeigehen, in dem die neuesten Modelle der Geschirrspül- und Waschmaschinen ausgestellt sind – oder sehen sie die überhaupt nicht mehr?
Die moderne Einbauküche, wie W.s Mutter sie hat, mit hochglänzender Nirostaspüle, aber ohne Wasseranschluss: wie die Indios in Mexiko, die einen Fernseher in ihrer Hütte ohne Stromanschluss stehen hatten. Allgemeiner: Wie wird der Widerspruch zwischen den kulturindustriell produzierten und täglich im Werbefernsehen erlebten Wohnbedürfnissen und der eigenen Wohnrealität bewältigt? Andererseits: Gibt es auch etwas aus der jetzigen Realität, das die Marienthaler hinüberretten wollen, wie z.B. die Bewohner von Eisenheim im Ruhrgebiet oder der Römerstadt bei Frankfurt, die es vorziehen, in ihren unmodernen Wohnungen, dafür aber unter intakteren sozialen Verhältnissen zu bleiben?
Als ich vor kurzem auf einem Spaziergang auf den Feldern hinter Marienthal entlanggegangen bin, hat es mich allerdings wie einen Schock getroffen: Da stehen sich die brandneuen oder noch im Bau befindlichen Einfamilienhäuser ›Aug in Aug‹ mit der Hinterbrühl gegenüber. Dort die grossen Fenster mit klaren, blitzenden Scheiben, hier blinde, zum Teil mit Pappe oder Stoff vernagelte Häuseraugen. Die Hinterbrühl ist Elend, einige Wohnungen sind überhaupt nicht mehr bewohnt, der Verfall greift über. Mein Eindruck des Elends ist bestimmt durch das Fehlen der kleinen gepflegten Vorgärten und durch die Apathie der auf dem Hof herumsitzenden Leute; keinerlei Betriebsamkeit wie in den Höfen der Hauptstrasse, keine spielenden Kinder.
76
Ich kam mit einem Mann in ein kurzes Gespräch. Er ist neunundfünfzig Jahre alt. Er ›lebt eben; jaja, man lebt eben‹, war sein ständiger Ausdruck. Er war schon um die frühe Mittagszeit angetrunken, und die Kombination von Alkohol und Resignation hat mich ziemlich deprimiert. Die Frau, die schweigend und kein einziges Mal lächelnd mit dabeisass, mich aber genau beobachtend, war auch angetrunken: Etwas weiter entfernt stand ein jüngerer Mann, ebenfalls schweigend. Alle drei sahen, bedingt durch ihren Zahnausfall, wahrscheinlich älter aus als sie waren. Irgendwie ist in ihre Haltung die Fremdbestimmung als Slum im Vergleich zu den Hauptstrassenhäusern eingegangen. Er sagte auch so etwas ähnliches wie »Na, haben Sie sich auch einmal hierher verirrt, wollen Sie auch einmal sehen, wie's hier zugeht.« Andererseits ist es wirklich die Frage, inwieweit ich schon die Vorurteile der Hauptstrasse mit übernommen habe, denn ganz unbefangen war ich nicht, als ich den Hof betreten habe.
Spaziergang durch das Neubaugebiet auf der anderen Seite der Hauptstrasse. Dort reiht sich ein Eigenheim an das andere, strassenzügeweise. Am Baustil ist abzulesen, dass sie in der Zeit zwischen den späten fünfziger Jahren und heute erbaut worden sein müssen und dass ihre Bewohner der Schicht der aufgestiegenen Proletarier bis zu den mittleren Angestellten angehören. Zuerst dachte ich, es handle sich hier weitgehend um Wiener Zuzugsgebiet, bis ich mit einem cirka fünfundvierzigjährigen Mann ins Gespräch kam, der mir erzählte, dass seine Heimat seit Generationen Marienthal ist. Sein Grossvater und Vater hätten noch in den Altbauten gewohnt, er dann schon in einem Gemeindeneubau, bis er sich im Eigenbau hier ein Haus errichtet habe. Er ist Schichtführer in der Glasfabrik im Nachbarort Moosbrunn und würde, wenn sie an einen anderen Ort verlegt wird, mitgehen. Er berichtete, dass über 90 %
77
der Bewohner des Neubaugebietes eingesessene Marienthaler seien, die ebenso wie er ihre Freizeit, Krankenstandszeit, Arbeit und ihr Erspartes in den Bau eines Eigenheimes stecken. (Krankfeiern scheint sehr gängig zu sein, wie aus der Selbstverständlichkeit abzulesen ist, mit der schon die Kinder darüber reden. Ist es durchschnittlich in Marienthal oder höher?)
Kennzeichnend für einen Selbstbau ist, dass er kollektiv, in der Form gegenseitiger Hilfe durchgeführt wird. Wer hilft wem? Liegen dem Verwandtschaftsverhältnisse oder Freundschaften zugrunde? Wie gestalten sich über solche Aktivitäten hinaus die nachbarschaftlichen Verhältnisse? Verhalten sich die Leute auch bei anderen Problemen dadurch verbindlicher zueinander? Soziologischer: Lässt sich eine Tendenz zur Aufhebung der durch privateigentümlich Normen bestimmten Verhaltensweisen feststellen?
Der kommunale Wasserkonflikt wirft auch hierher seine Schatten: Die Eigenheimbesitzer haben alle ihre eigenen Brunnen und aus diesem Grund nicht die mindeste Lust, an die offizielle Wasserleitung angeschlossen zu werden und dafür auch noch zu zahlen. Dieser Wasserleitungsbau scheint auch die politische Dimension von Selbstorganisation versus Behördenzwang zu haben.
Es war bitter, von hier, der sunny side of the street, an die Hauptstrasse zu denken; zu sehen, dass die in den kleinen Fragebogen vorgebrachten Kinderwünsche hier Realität sind: Es gibt sowohl das eigene Pferd wie den Swimming Pool, und es ist nicht eine Realität irgendwelcher Fremden, sondern derer, die man schon lange kennt, die vielleicht einmal neben einem gewohnt haben, mit denen man vielleicht sogar den Wunsch nach einem solchen Leben, nach eigenem Haus, geteilt und besprochen hat; nur dass
78
die einen es geschafft haben und die anderen zurückgeblieben sind in den Altbauten.
Noch eine Spekulation dazu, die empirisch untersucht werden könnte: Durch den Auszug der mittleren Altersgruppe blieben einerseits sehr viele alte Leute, vor allem Witwen, in den Altbauten zurück und Familien, die es sozial und beruflich nicht geschafft haben. In die leeren Wohnungen zogen nun Jugoslawen nach. Wird die Enttäuschung über den misslungenen Aufstieg als Feindseligkeit auf die Immigranten projiziert? Ausserdem würde ich gern herausfinden, was so eine Familie als Werte schätzt, um zu sehen, ob sie ihre Armut als gerecht internalisiert haben, wie z.B. dass es eben von Natur aus Bessere und Schlechtere gibt. Oder beinhalten ihre Werte auch eine kritische Tendenz, wenn z.B. das ›einfache Leben‹ dem Konsumzwang vorgezogen oder Radio, Fernsehen, ständige Musikberieselung als bewusstseinsmanipulierend abgelehnt wird? (Meine romantischen Verklärungen?) Dergestalt würden auch die Bewohner der Hinterbrühl sich nicht mehr als Bodensatz der Gesellschaft begreifen, müssten ihren Selbsthass nicht im Alkohol ertränken. Vermutlich aber die die Gesetze des sozialen Vergleichs, des von aussen gesetzten Anspruchsniveaus doch sehr stark. Auch in den Höfen blitzen ja die Autos, und schon die Kinder vergleichen ihre Fahrräder, die noch Kleineren ihre ›Softball‹-Ausrüstung. Und der Fernseher wird nicht abgedreht, im Gegenteil, unlängst verliessen die meisten Pensionisten eine Festveranstaltung im Gasthaus, weil um Viertel nach acht eine TV-Serie begann.
Wie steht es um das Beziehungsgeflecht in Marienthal? Nach den Bemerkungen der Kinder kommt es mir so vor, als gäbe es hier besonders starke, weil ja auch räumlich so nahe Verwandtschaftsbeziehungen. Dauernd ist von Cousins und Cousinen die Rede, von Oma, Onkel, Tanten usw. Resultiert daraus ein bestimmtes Sippenverhalten, das eine
79
soziale Definitions- und Kontrollinstanz darstellt? Die Höfe als Gemeinschaftsräume: Entstehen dort zusätzliche Normen oder herrscht Anomie? In welchem Verhältnis stehen die Höfe zueinander, sind sie ähnlich, gibt es eine Hierarchie? Wie überlagern sich die Subsysteme von Höfen, Wohngegenden, Verwandtschaften? Gerade weil hier in Marienthal etwas aus der Vorkriegszeit physisch, aber auch sozialpsychologisch übriggeblieben ist und sich gleichzeitig an den modernen Zuständen messen muss, scheint es mir eine Möglichkeit, das Nebeneinander und das Konflikthafte von Ungleichzeitigem zu sehen und verstehen zu lernen.
Ich denke, in jedem einzelnen der Menschen hier steckt die Sehnsucht nach Glück; aber was stellt er oder sie sich darunter vor? Jeder hat zufrieden stellende und unglückliche Erfahrungen hinter sich, die er für sich durchdacht hat und nach denen er sein Leben zu gestalten versucht. Ich finde keine dieser Erfahrungen langweilig und versuche, sie genauso ernst zu nehmen wie mich selbst.
G.O. [d.i. Gerhild Ohrenberger; Anm. R.M.]
5.3. Medienarbeit in Marienthal
Im folgenden Erfahrungsbericht werden die Studien unserer Arbeit mit audiovisuellen Medien als integraler Bestandteil des Projekts dargestellt bzw. nochmals zusammengefasst. Wechselwirkend mit den ›Betroffenen‹, d.h. sowohl uns als auch den Bewohnern, lassen Schlüsse für einen vertieften Umgang mit Dokumentationstechniken.
Die Autoren der Studie von 1933 benutzten ein ganzes Repertoire von innovativen Methoden, um über die Lebensgewohnheiten und das Lebensgefühl der Bewohner von Marienthal
80
Aussagen machen zu können. Sie wurden allerdings über die Köpfe der Leute hinweg angewendet; das heisst, die Kleidersammlung war nicht nur Kleidersammlung (und als solche eine adäquate Reaktion auf materielle Not), sondern gleichzeitig Überprüfung der Haushaltsbestände. Der Besuch beim Arzt war nicht nur notwendige Vorsorgeuntersuchung, sondern gleichzeitig Datenerhebung für die Gesundheitsstatistik (Dieser Punkt scheint mir auch problematisch wegen des impliziten Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient).
Selbst in der engagierten Marienthal-Studie ist das Subjekt-Objekt-Verhältnis nicht aufgehoben. Sozialpsychologischer Forschung haftet immer noch das Stigma sozialer Kontrolle an, die Marienthal-Studie macht hier keine Ausnahme.
Fünfzig Jahre später hatten wir in Marienthal die Gelegenheit zu erfahren, inwieweit sozialwissenschaftliche Forschung zu den ›Betroffenen‹ zurückkommt. Auch hier ist die Marienthal-Studie sicher nur ›ein Beispiel von vielen‹ und durchaus nicht die Ausnahme: Wenn die Forscher den Ort ihrer Untersuchung verlassen, ist das Interesse von den jeweiligen Bewohnern abgezogen, und sie existieren höchstens weiter als statistische Daten in den Forschungsberichten. Die Ergebnisse kommen nicht zurück. Bei den Betroffenen bleibt das vage Gefühl, in ein Projekt einbezogen worden zu sein, dessen Bezugsrahmen und dessen Tragweite uneinsichtig bleiben müssen.
Auch wir konnten uns diesem Forschungsdilemma nicht entziehen oder es gar lösen. Die Überlegungen und Frustrationen waren aber ausschlaggebend dafür, dass wir uns entschlossen, neben den üblichen Erhebungsmethoden schwerpunktmässig mit audio-visuellen Medien zu arbeiten. Unsere Arbeit in Marienthal war der Versuch, die Bevölkerung
81
als aktive Gruppe in unser Forschungsprojekt einzubinden und durch den Einsatz der Medien soziologische oder sozialpsychologische Vorgehensweisen zu versinnlichen.
Bestandaufnahme der verwendeten Medien:
Wir haben versucht, unsere Forschungsarbeit für die Bewohner von Marienthal so transparent wie möglich zu machen. Dies wurde entscheidend dadurch erleichtert, dass uns das Gemeindeamt von Gramatneusiedl eine Wohnung in der Hauptstrasse von Marienthal zur Verfügung stellte. Dadurch hatten wir eine ständige Kontaktadresse in Marienthal, einen Raum, um die diversen Geräte unterzubringen, Besuch zu empfangen und nicht zuletzt einen Platz, um zeitweilig in Marienthal zu wohnen.
Den Marienthalern gegenüber war unser Forschungsinteresse von Anfang an folgendermassen definiert: Ausgehend von der Originalstudie von 1931 wollten wir erfahren,
|
(1) |
wie die Marienthaler die Zeit der Depression und Arbeitslosigkeit am eigenen Leib erfahren haben, |
|
(2) |
wie die Geschichte Marienthals in den letzten fünfzig Jahren nach Abschluss der Originalstudie weitergegangen ist und |
|
(3) |
wie das Leben heute in Marienthal abläuft. |
Punkt (1) und (2) waren für die Marienthaler einsichtiger als die Erforschung des gegenwärtigen Zustandes, weil Marienthal von seinen Bewohnern unwichtig, peripher und in keiner Weise modellhaft erlebt wird. Ausserdem setzten offensichtlich in Bezug auf die Gegenwart die diversen Barrieren gegenüber Fremden und die Furcht vor potentieller Kontrolle in verstärktem Masse ein.
82
Flugblätter
Zur Selbstdarstellung unserer Gruppe und Definition unseres Forschungsinteresses machten wir zunächst im August 1979 einen öffentlichen Anschlag am Gemeindeamt, in Schaukästen und -fenstern und entlang der Hauptstrasse von Marienthal. Inhalt: Vorstellung der Arbeitsgruppe Marienthal 1930 bis 1980 verbunden mit der Einladung an die Bevölkerung, Näheres über unser Projekt bei einem Treffen im Gasthaus zu erfahren. Das Flugblatt war auf deutsch und jugoslawisch verfasst.
Die direkte Resonanz dieser ersten Aktion mit dem Versuch, unsere Arbeit in Marienthal öffentlich zu machen, war gleich null. Niemand erschien zu dem ersten Treffen im Gasthaus: Auf einer informellen Ebene brachte dieses erste Flugblatt allerdings wichtige Informationen – Einstieghinweise, die uns erst bewusst wurden, nachdem wir unsere Frustration etwas relativieren konnten. Wichtigstes Ergebnis: Die Einstellung den jugoslawischen Gastarbeitern gegenüber. Die alteingesessenen Marienthaler machten es uns zum Vorwurf, dass wir den Text auch auf jugoslawisch verfasst hatten. »Die Gastarbeiter können doch über Marienthal nichts sagen und schon garnicht über seine geschichtliche Entwicklung!« Diese Formulierung der Ingroup / Outgroup-Problematik begegnete uns auf allen Ebenen unserer Untersuchung.
Aufgrund des Flugblattes bekamen wir aber viele brauchbare Hinweise, wo wir die Marienthaler eher treffen könnten: z.B. nicht bei schönem Wetter nach Feierabend im Gasthaus, sondern auf dem Fussballplatz etc.
83
Gemeindezeitung
Zur gleichen Zeit stellten wir unser Projekt in der Gemeindezeitung ›Gemeindeforum‹ vor. Die Zeitung wird vierteljährlich an jeden Bewohner in Gramatneusiedl kostenlos verteilt. Wir haben auch zu späteren Zeitpunkten die Gemeindezeitung dazu verwendet, um über unsere Arbeit zu berichten.
Photoausstellung
Der erste grössere Medieneinsatz erfolgte dann im September 1979. Innerhalb einer Woche photographierten wir die Kinder von Marienthal, und zwar einzeln (in Ausnahmefällen wollte ein Kind nur zusammen mit einem anderen aufgenommen werden) und in einer bewussten Porträtpose mit Blick in die Kamera – eine Art des Photographierens, die sich vom Schnappschuss oder der distanziert ›eingefangenen‹ Situation unterscheidet und den Kindern eine gewisse begrenzte Möglichkeit zur Selbstdarstellung geben sollte. Nachträgliche Überlegungen gehen in die Richtung, ob nicht der Selbstdarstellungscharakter besser gewährleistet worden wäre, wenn man die Kinder in einer Umgebung ihrer Wahl photographiert hätte. Gleichzeitig entsprache [!] die frontale Photographierpose auch dem Klischee der Familien- und Amateurphotographie und verdoppelte dadurch auch eine sozialisierte Auffassung, wie eine repräsentative Photographie auszusehen habe. Die Photos wurden dann in schwarz-weissen A 4–Abzügen in den Parterrefenstern der Hauptstrasse ausgestellt. Diese Photoaktion hatte eine ungeteilt positive Resonanz. Für uns erweiterte sie den Bezugskreis in Marienthal, nicht nur durch das Photographieren, sondern auch vor allem durch die darauf folgenden Verhandlungen, welche Photos in welchen Fenstern ausgestellt würden.
84
Es war gut, dass ziemlich zu Anfang unseres Projektes in Marienthal schon so ein konkretes ›anschauliches‹ Resultat vorlag. Die Hauptstrasse, deren soziale Funktion durch den starken Verkehr stark beeinträchtigt ist, wurde in der Zeit der Ausstellung wieder ansatzweise ein öffentlicher Platz der Kommunikation.
Schwierigkeiten ergaben sich bei dem Wunsch der Kinder bzw. ihrer Eltern, ein Bild oder mehrere Abzüge zu besitzen. (Besonders im Photobereich fielen viele unserer Entscheidungen ad hoc und entwickelten sich während der Arbeit vor Ort, d.h. sie waren auch in unserem Budget nicht eingeplant. Unser gesamter Budgetposten für Photographie und Kopierkosten war praktisch durch diese zunächst nicht geplante Aktion verbraucht.). Wir versuchten, dem Wunsch der Kinder so gerecht zu werden, dass jedes Kind eine (gute) Photokopie der Photos erhielt – die Photographie wurde aber nicht als Photoersatz akzeptiert.
Gleichzeitig mit einer gewissen Legitimierung unserer Präsenz in Marienthal (»Das sind die Leute die Photos machen und sich für Geschichten aus Marienthal interessieren.«) und dem Spass an der Ausstellung war also mit dieser Aktion auch eine erste Schwierigkeit verbunden: Wir halten nicht, was das Medium Photographie verspricht, jeder hat ein Anrecht auf sein Bild, wir können die Bilder nicht uneingeschränkt reproduzieren, behalten uns aber selber ein Bild der betreffenden Personen.
Plakate
Auf die Strassenausstellung wiesen wir mit den Din A2–Plakaten hin, auf denen rosettenförmig immer andere Porträtphotos der Kinder reproduziert waren, und die in allen Schaufenstern der Hauptstrasse angebracht waren. Ihr Beliebtheitsgrad liess sich im übrigen (im Sinne der ›nichtteilneh-
85
menden Beobachtung‹) daran ermessen, wie viele Plakate schon in den ersten Tagen verschwunden waren.
Video-Arbeit
Gleichzeitig mit der Photoaktion begannen in verstärktem Masse die Arbeiten für die Video-Dokumentation. Die Photoausstellung in der Hauptstrasse und die Kinderphotos sind Teil der Video-Dokumentation geworden.
Video-Feedback
Noch im September 1979 stellten wir die ersten Resultate der Video-Arbeit in Marienthal vor. Ein warmer Spätsommerabend ermöglichte eine Freiluftvorführung und eine rege Teilnahme der Bevölkerung. Die Ergebnisse wurden mit lauten Kommentaren aufgenommen und kritisiert. Es wurden sofort neue Anregungen gegeben. Am meisten berührte die Marienthaler immer wieder der schlechte bauliche Zustand ihrer Siedlung. So wollte man nicht öffentlich dargestellt werden, die Revitalisierungsabsichten sollten inhaltlich eher im Vordergrund stehen. Die Gegenposition lautete, dass die Häuser nun mal so desolat aussähen und dass es nur gut sei, dass diese beschämende Tatsache auch einmal an die Öffentlichkeit käme. Es wurde auch über die Relativierung des photographischen Abbildes diskutiert: Auf manchen Einstellungen sah Marienthal in der Sommersonne mit seinen Höfen und Balkons aus wie eine malerische, südliche Urlaubsstadt. Diese Abbilderfahrung war ein sinnlicher Einstieg in das Überdenken der Objektivität der Medien – d.h. an eine Diskussion über die direkt erlebte Diskrepanz zwischen aufgezeichnetem Bild und täglich erlebter Wirklichkeit.
86
Video-Chronik
Von diesem Zeitpunkt an erstellten wir eine Video-Chronik der Ereignisse in Marienthal, privat und öffentlich: eine Taufe, eine Hochzeit, das Volksfest, der Fussballverein in einem entscheidenden Spiel der Regionalliga; diverse Feste: Pensionistenball, Faschingsfest; Diskussionsrunden: Gewerkschaft, Jugoslawen zur Ausländerproblematik, Familienszenen etc. Und immer wieder wurden Zwischenergebnisse in Marienthal ›zurückgespielt‹, und zwar zusätzlich zu der direkten Wiedergabe nach einer Aufnahme, wo es durchaus vorkam, dass die eben gefilmte Person kritisierte: »Das hätte ich nicht sagen sollen, das gefällt mir nicht!« Selbstverständlich wurden im Endschnitt solche Korrekturen berücksichtigt. Uns bleibt auch als Bild im Gedächtnis, wie eine alte Frau sich nach ihrem Interview aufmerksam im Fernsehschirm wieder zuhört und immer wieder bestätigend sagt »ja, genau so war es« und ganze Textpassagen parallel mitspricht, während sie vor ihrem eigenen Fernsehbild sitzt.
Interpersonal Process Recall
In verschiedenen Gesprächssituationen wandten wir die Technik des Interpersonal Process Recall (IPR) nach Kagan an (vgl. etwa Kagan et al., 1967). Dabei geht es im Kern darum, sich selbst, d.h. das eigene Video-Bild, in der eben stattgefundenen Situation zu sehen und auf die Gefühle und Assoziationen zu achten, die die Wiederholung begleiten. Wir nahmen z.B. ein Ehepaar bei einem langen Gespräch über ihr Zusammenleben auf. Die Problematik der Kindererziehung kam zur Sprache, der Alkoholismus des Mannes und die Art, wie die Frau damit umgeht. Gemeinsam sahen wir uns das Band an. Die Eheleute sahen von einer zugleich objektiven wie subjektiv-wiedererlebenden Warte, wie sie miteinander umgingen, aufeinander reagierten, dem Partner zuhörten bzw. über ihn hinwegargumentierten.
87
Vorführung der Video-Dokumentation
Von den cirka dreissig Stunden Aufnahmematerial gelangten natürlich nur ein Bruchteil in die Endfassung. Aber zum grossen Teil wurden die Bänder so aufgenommen, dass sie jeweils eine Einheit in sich bilden und einem speziellen Interessenkreis vorgespielt werden können. Eine zweistündige Fassung der Dokumentation wurde im Sommer 1980 in der Gemeinde uraufgeführt, zuerst in der Hauptschule von Gramatneusiedl und erst nach vierzehn Tagen in Marienthal. Diese Entscheidung war aufgrund der grösseren technischen Möglichkeiteb [!] im neuen Schulzentrum getroffen worden; erwies sich aber als ungeschickt. Selbst in diesem späten Stadium unserer Untersuchung hatten wir die psychologischen Barrieren zwischen Marienthal und Gramatneusiedl unterschätzt. Nicht viele ›alte Marienthaler‹ wohnten der ersten Aufführung bei. Dafür aber die Honoratioren von Gramatneusiedl, der Bürgermeister [d.i. Klaus Soukup; Anm. R.M.], viele Gemeinderäte. Die Dokumentation wurde sehr kritisch und zum Teil ablehnend aufgenommen. Wir hätten Marienthal als Slum dargestellt, – die Gemeinde täte doch alles, um den desolaten Hausbestand zu sanieren. Und immer wieder die Frage bzw. der explizite Vorwurf, was denn die Jugoslawen in einer Dokumentation über Marienthal zu suchen hätten. Diese Meinungen wurden in einer hitzigen Debatte, bei der sich einige Gemeindevertreter zu profilieren suchten, erörtert. Ausserdem hatten wir einen kurzen Fragebogen vorbereitet, um die Reaktion auf die Video-Arbeit umfassender auswerten zu können.
Die Vorführung in Marienthal selbst verlief hingegen weitgehend in freundlichem Einverständnis. Bei dieser Vorführung war auch Marie Jahoda anwesend, was dem Abend natürlich eine zusätzliche Attraktivität verlieh. Allerdings wurde
88
auch diesmal die Einbeziehung der Gastarbeiterproblematik wieder heftig kritisiert, was für uns eine Bestätigung war, dass diese Frage einer der zentralen interaktiven Problempunkte in Marienthal ist, schliesslich leben einige Ausländerfamilien schon über zehn Jahre am Ort.
Durch diese Video-Vorführungen und die anschliessenden Diskussionen, die zum Teil wieder auf Band aufgenommen wurden, hatten die Marienthaler unseres Erachtens das Gefühl, dass Ergebnisse unserer Arbeit, die sie über den Zeitraum von einem Jahr mitverfolgt hatten, zu ihnen zurückkamen. (Viele Marienthaler nahmen übrigens die Gelegenheit wahr, sich das Band in Wien noch einmal anzuschauen, wo es wiederholt vorgeführt wurde.) Kritisch anzumerken ist, dass fast keine Jugoslawen zu den öffentlichen Vorführungen kamen, obwohl unsere Beziehungen zu einigen Gastarbeiterfamilien sehr gut waren. Wir haben es versäumt, das Videoband in einer Extra-Vorführung den Jugoslawen zu zeigen, beispielsweise im jugoslawischen Klub in Gramatneusiedl. Diese Möglichkeit fällt mir erst nachträglich ein, sie wurde gar nicht diskutiert. Ich vermute, dass wir uns unbewusst nicht den expliziten Ärger der Marienthaler zuziehen wollten.
Video und Fernsehen
Interessant war auch der von den Marienthalern selbst angestellte Vergleich unserer Arbeit mit der Arbeit des ORF. Anlässlich einer Diskussionssendung über Arbeitslosigkeit wurde ein etwa dreiminütiger (!) Ausschnitt unserer Arbeit als begleitende Diskussionsgrundlage ausgestrahlt, eingebettet in einen kurzen magazinartigen Beitrag über die Situation in Marienthal, den ein Kamerateam des ORF in wenigen Stunden aufgenommen hatte. Obwohl hier der Reiz der öffentlichen Ausstrahlung hinzukam, kritisierten einige
89
Marienthaler die oberflächliche, distanzierte Arbeit des ORF, räumten aber ein, dass ein Kamerateam nicht für jede kurze Berichterstattung mehrere Monate an einem Ort bleiben könne.
Das Fernsehen steht in Marienthal (wie anderswo auch) im absoluten Zentrum der Freizeitgestaltung. Der Bildschirm hat eine geradezu magische Anziehungskraft und ist der zweidimensionale Vermittler zur Erfahrung der Welt. Diese magische Anziehungskraft des Mediums ist natürlich mitentscheidend für das starke Interesse, wenn über dasselbe Format, aber in verschiedenen Graden der Öffentlichkeit, eine Darstellung der eigenen Lebensverhältnisse erlebt wird.
Solche Versuche machen die Allmacht des Mediums angreifbar und setzen Masstäbe für eine ›alternative‹, sozial engagierte Medienarbeit. Die zentrale Wichtigkeit des Fernsehens im Tagesablauf wird hier – wahrscheinlich zum ersten Mal – auf eigene Belange gelenkt und der Wirklichkeitserfahrung durch das Fernsehen eine entscheidende Dimension hinzugefügt.
Radio
Am 28. April 1981 wurde in einer Sendereihe des Hörfunkprogrammes ›Memo‹ eine Sendung über Marienthal gebracht. ›Marienthal – eine Ortschaft erinnert sich.‹ Mit kurzen einleitenden Texten, die vor allen Dingen für die Chronologie in der Abfolge sorgen sollten, kamen hier Marienthaler im O-Ton zu Wort.
Mit der Methode der ›Oral History‹, der erzählten Lebensgeschichten, hatten wir in zwanzig langen Interviews die Geschichte Marienthals und seiner Bewohner aus der subjektiven
90
Perspektive der Betroffenen aufgezeichnet. Nach jeweiliger Rücksprache mit dem Gesprächspartner wurde aus diesem Material die vierzigminütige Sendung zusammengeschnitten. Während des Sendetermins waren wir in Marienthal und haben die Sendung gemeinsam mit mehreren Bewohnern gehört. Neben der offensichtlichen Genugtuung, im Rundfunk über Marienthal von Marienthalern berichtet zu hören, erhielten wir aufgrund dieser Sendung viele neue Hinweise, wer uns noch etwas aus der Vergangenheit Marienthals zu berichten hätte. Es ist wohl ein grosses Bedürfnis, in solchen langen Gesprächen die Gelegenheit zu bekommen, die Vergangenheit vor einem interessierten Zuhörerkreis Revue passieren zu lassen, auch und gerade dann, wenn die erlebte Geschichte mit der offiziellen Geschichte nur in ganz groben Rastern in Einklang zu bringen ist.
Wir wurden aber auch anlässlich der Sendung immer wieder kritisiert in Bezug auf die Personenauswahl, die wir für den Zusammenschnitt getroffen hatten. Aus den verschiedenen Gründen (Parteizugehörigkeit, »Die ist erst seit sechsundzwanzig Jahren in Marienthal«, »Der war ein Nazi« etc.) wird Einzelnen das Recht abgesprochen, gültige Aussagen über Marienthal zu machen.
Oral History
Die Methode der ›Oral History‹ ist eine befriedigende und ergiebige Arbeitsweise, aber auch problematisch, weil die Auswahlkriterien, was interessant und relevant ist, nicht klar definiert werden können. Unser Fragenkatalog orientierte sich grob an den Schlüsselereignissen österreichischer Geschichte: Arbeitslosigkeit, Ständestaat 1934, Anschluss 1938, Faschismus, Krieg, Befreiung, Nachkriegsmisere, Wiederaufbau. Zu jedem Stichpunkt gibt es potentiell eine Überfülle an persönlichen Erlebnissen. Manche
91
Ereignisse, z.B. Kriegserlebnisse, werden in ausufernden Schilderungen dargestellt und es wird dann sehr schwierig, das Gespräch auf den eigentlichen historischen roten Faden zurückzubringen. Andere Erfahrungen werden übergangen oder selbst bei Nachfrage ganz kursorisch und zweitrangig karg abgehandelt, z.B. die Zeit des Faschismus (vgl. ähnliche Resultate bei der Amsterdamer Konferenz zum Thema ›Oral History‹, etwa Lummis, 1980).
Die erzählte Lebensgeschichte ist sicher eine sehr wichtige Form der Bestandsaufnahme von Alltagsgeschichte und subjektiver Erfahrung. Es ist uns aber in unserer Arbeit mit dieser Methode nicht gelungen, wirklich ein konzeptuelles Raster zu finden, in dem diese vielfältigen Erfahrungsberichtem, Anekdoten, Beschreibungen methodisch eindeutiger und selektiver ausgewertet werden können.
Ton-Dia-Schau
Das vorläufig letzte Produkt unserer Medienarbeit war eine fünfundzwanzigminütige Ton-Dia-Schau, die anlässlich der Arbeiterkulturausstellung ›Mit uns zieht die neue Zeit‹ täglich gezeigt wurde. (Wien, Remise Koppreithergasse, Januar bis Oktober 1981).
Hier kam es uns vor allem darauf an, auf die Photographie medienreflexiv hinzuweisen. Wir arbeiteten parallel mit zwei Dia-Projektoren à achtzig Bilder. Die Bildpaare waren einander so zugeordnet, dass sich meistens ein historischer Bezug ergab. Auf der linken Seite erschienen jeweils die Reproduktionen alter Schwarzweissphotos, die uns die Marienthaler zur Verfügung gestellt hatten, auf der rechten Seite von uns 1979/80 gemachte Farbdias. Es sollte dadurch ermöglicht werden, ein Photographierverhalten zu
92
vergleichen. Die grosse Familie damals oder sogar die Hofgemeinschaft, die Kleinfamilie oder der Einzelne heute, die Vielfalt der Vereine und kollektiven Identifizierungsmöglichkeiten, die eher individualistische Tendenz heute. Bei dieser Ton-Dia-Schau war uns wichtig, auch von Marienthalern gemachte Photos vorzustellen. Es handelte sich aber in den meisten Fällen um alte Photos aus den Familienalben mit dem Schwerpunkt Arbeitslosigkeit. Es wäre sicher ebenso adäquat gewesen (allerdings nicht für diese Ausstellung, die ja den historischen Bezug thematisch vorgegeben hatte), die ganze Dia-Vorführung nur aus Photos der Marienthaler zusammenzusetzen, und zwar besonders aus neueren Photos, die hätten dokumentieren können, wie Marienthaler selbst ihre Umgebung wahrnehmen.+
Diese Bestandaufnahme geht sicher zu wenig auf die Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten unserer audiovisuellen Arbeit ein. Es soll nicht der Eindruck entstehen, als ob diese Medienarbeit nur problemlos, in vollstem Einverständnis mit den Marienthalern und durchgehend erfolgreich gewesen wäre.
___________
[+] Bei einem späteren Projekt, »Zur Problematik der Existenzgründung von Jugendlichen im ländlichen Raum», durchgeführt in der Gemeinde Geras im Waldviertel, habe ich versucht, die Ebene der Amateurphotographie in die Dia-Vorführung miteinzubeziehen. Die Bereiche der Amateurphotographie sind vornehmlich: Familie, Feste, Urlaub, Gruppen allgemein. Ausgeklammert ist der kommunale- [!] und der Arbeitsbereich. Fast völlig ausgeklammert ist [!] das äussere Erscheinungsbild der Heimatgemeinde und diesbezügliche Veränderungen, dafür gibt es aber viele Aufnahmen der umgebenden Landschaft, Natur, Tiere, die ich in meiner eigenen dokumentarischen Photoarbeit völlig ausgelassen hatte.
93
Sicher haben wir versucht, auf zu vielen Ebenen gleichzeitig zu arbeiten, so dass wir die Bedingungen und Möglichkeiten der einzelnen Medien nicht genauer erarbeitet haben.
Die Bestandsaufnahme geht auch nicht in genügendem Mass auf die vielen Barrieren ein, die bei jeder Medienarbeit immer wieder auftreten. Es ist durchaus nicht so, dass wir überall mit offenen Armen empfangen wurden. Photographieren bedeutet immer das – aggressive – Überwinden einer sozialen Distanz. Zum Teil wurde diese Distanz in beginnender Freundschaft oder vorübergehendem Vertrauen aufgelöst, zum Teil aber der Kontrollcharakter der Photographie deutlich präsent, denn Photographie ist ja immer potentiell auch Fahndungsphoto, seitdem die Polizei bei der Niederschlagung der Commune 1871 die Photographie zum ersten Mal zur diskriminierenden Identifizierung verwendet hat. Gerade Marienthaler, die in der Vergangenheit politisch verfolgt wurden, wollten nicht aufgenommen werden, um zu vermeiden, dass zu einem späteren Zeitpunkt irgendjemand sagen kann: »Da, das ist er / sie!«.
Anzumerken ist auch, dass sich aus unserer Anwesenheit in Marienthal keine kontinuierliche Medienpraxis für die Ortschaft entwickelt hat. Wir sind wieder weg und haben die Geräte, ein gewisses technisches Know-how und auch einen beschränkten Zugang zu einer grösseren Öffentlichkeit wieder mitgenommen.
Wünschenswert und der Beginn einer wirklich emanzipatorischen Medienarbeit wäre die Entwicklung einer autonomen Mediengruppe auf regionaler oder lokaler Ebene. Diesen Ansatz haben wir nicht leisten können.
94
Aber die Medienarbeit gehörte sicher zum befriedigendsten und lustvollsten teil unsere Projektarbeit in Marienthal. Die Video-Dokumentation und manche der Photos sagen in ihrer erlebten sinnlichen Präsenz m.E. zumindest soviel über die Ortschaft Marienthal und ihre Bewohner aus wie die Versuche, empirische Daten nach vorher definierten Annahmen in sinnvollen Bezug zueinander zu bringen und von da eine potentiell verändernde Praxis zu erarbeiten.
B.F. [d.i. Birgit Flos; Anm. R.M.]
95
6. Schluss?
Nach den Interviews und Aufzeichnungen, der Auswertung und Dokumentation wäre es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Aber unsere Arbeit ist offen geblieben, ihre Details sind nicht durch ein ›Hauptergebnis‹ zusammenzufassen. Vor fünfzig Jahren, in der Arbeitslosen-Studie, ging es um ein massives soziales Trauma, heute geht es um graduelle Veränderungen in einer peripheren Pendler- und Pensionistengemeinde. In den Fluss der Ereignisse wollten wir nicht Hypothetisches nachweisen, sondern beobachten und verarbeitend vermitteln.
Die Arbeit ist auch offen geblieben, weil wir durch die Begegnung mit den Bewohnern auf Dimensionen gestossen sind, die sich nicht einfach abschliessen liessen. So kristallisierte sich etwa im Laufe der Arbeiten ein Schema von Zugehörigkeiten zum Ort heraus, nicht präzise genug für die Formulierung einer Typologie wie der ›Haltungstypen‹ der alten Studie, aber erkennbar und bezeichnend für die heutige Situation in Marienthal.
Wir fanden zum einen ein Gefühl grundlegender Verbundenheit mit dem Ort und seinen sozialen und verwandtschaftlichen Strukturen vor, bei ›Alteingesessenen‹ aller Altersstufen (vgl. die Fallstudie der Brüder K.), obwohl naturgemäss die Älteren vorherrschen. Sie zeigen Interesse für die Entwicklung Marienthals und fühlen sich mit seiner spezifischen politischen Geschichte und seiner möglichen Zukunft verbunden.
Häufiger sahen wir eine zweckrationale Einstellung zu Marienthal: Man akzeptiert es als Schlaf- und Wochenendwohndorf, schätzt die Vorteile der Stadtnähe und die Annehmlichkeiten des Landes, des eigenen Schrebergartens – Eigenschaften, die mehr oder weniger austauschbar sind. Typisch
96
ist diese Haltung für Pendlerfamilien und zugereiste Arbeiter oder Angestellte, die sich über die Jahre den Nachbarn oder bestimmten Vereinen, aber nicht dem Ort als Ganzem verbunden fühlen.
Für manche ist Marienthal schliesslich eine Not- oder Übergangslösung im Berufsleben. Sie mögen aus dem Ort selbst kommen oder zugereist sein, ihr Wunsch jedenfalls ist abzureisen. Sie wollen nicht gern mit Marienthal in Verbindung gebracht werden. Sozialkontakte gehen nicht über ein Mindestmass alltäglicher Interaktion hinaus. Die jugoslawischen Gastarbeiter sind zum Teil dieser Gruppe, zum Teil dem zweckrationalen Typus zuzuordnen: Viele von ihnen haben ein reges, wenn auch nicht integriertes Sozialleben entwickelt und aus dem Wohnen in Marienthal mehr als eine Notlösung gemacht.
Fast zufällig wurden wir auch Zeugen des letzten Kapitels der alten Siedlungshäuser. Wir wussten um ihre architekturhistorische Relevanz. Allmählich lernten wir auch die halböffentliche Raumfunktion der Höfe kennen und ihre Bedeutung für nachbarschaftliche Verhältnisse. Wir erlebten die Probleme der überalterten Baustruktur, der hygienischen Anlagen und der Kaltwasserbrunnen, sahen aber auch ihre integrative Funktion.
Die sozialpsychologische Betrachtung führte uns zur Architektur als Rahmen für weitere soziale und interaktive Codes. Die Zeichen sind bereits gesetzt, die Revitalisierung bis ins Detail geplant und, wie wir kurz vor Abschluss dieses Berichts erfahren, auch an einigen Wohnungen schon durchgeführt. Aber die Entscheidung über die Neugestaltung der Hinterhöfe ist noch nicht gefallen. Wenn unsere Hinweise auf die Bedeutung des Siedlungsensembles, unsere Gespräche mit Bewohnern, mit dem Bürgermeister [d.i. Klaus Soukup; Anm. R.M.] und dem Architekten [d.i. Josef Hums; Anm. R.M.]
97
nur die eine oder andere Überlegung bewirkt haben, die Arbeitersiedlung auch als sozialpsychologische Entität ernstzunehmen, dann waren unsere Beobachtungen des sozialen Lebens in der Siedlung die Mühe vielleicht wert. Eines allerdings wird sich kaum noch herbeiführen lassen, das vermuteten schon die Autoren 1932 und das zeigt sich fünfzig Jahre später noch deutlicher: Es wird keine grossen Gruppenbilder mehr geben wie in den frühen Tagen der Ortsgemeinschaft.

98
Literatur
ADORNO, T.W. et al., The authoritarian personality. New York, Harper, 1950.
ADORNO, T.W. Scientific experiences for a European scholar, Perspectives in American History, Harvard University, Vol. II., 1968, (Deutsch: Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika. Neue deutsche Hefte, Jahrgang 16, Heft 2, Juni 1969)
Architektenbüro Dipl. Ing. Josef Hums und Dipl. Ing. Alois Seliger, Schwechat, Studie zur Revitalisierung in Marienthal, Gemeinde Gramatneusiedl, Juni 1979.
CHRISTIE, R[ichard] und JAHODA, M. (Eds.) Studies in the scope and method of ›The authoritarian personality‹. Glencoe, III.: Free Press, 1954
FLEMING, D[onald] und BAILYN, B[ernard] (Hg.) The intellectual migration: Europe and America 1930–1961, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969
FLOS, B., FREUND, M. und MARTON, J., Health and mental Health in Marienthal. Unpublished paper submitted to the World Health Organization, Geneva, Wien 1981
FREUND, M., Sociography: The Marienthal Story, Austria Today, Vol. IV., Fall 1978
GARRATY, J[ohn] A[rthur], Unemployment in history, Economic thought and public policy, New York: Harper & Row, 1978
GITLIN, T[odd], Media Sociology: The dominant paradigm. Theory and Society, 1978, 6
GEFFRATH, M.[recte Greffrat, Mathias; Anm. R.M.], Die Zerstörung einer Zukunft. Gespräche mit emigrierten Sozialwissenschaftlern. Reinbek: Rowohlt, 1979
HAUER, N[adine], Von Marienthal nach New York. Zum 80. Geburtstag von Paul Lazarsfeld. Wiener Tagebuch, Jan. 1981
HORKHEIMER, M[ax] (Heinrich Regius): Dämmerung. Paris 1934.
99
JAHODA, M. Unemployed men at work. A social-psychological study of the Subsistence Production experiment in the Eastern Valley of Monmouthsire. Unveröffentlichtes Manuskript, 1938.
JAHODA, M., LAZARSFELD, P.F., and ZEISEL, H. Die Arbeitslosen von Marienthal. Frankfurt: Suhrkamp, 1975.
JAHODA, M. Arbeitslose haben alles Recht der Welt, über ihre Lage unglücklich zu sein. Interview in: Psychologie Heute, Dez. 1981
KAGAN, N[orman] et al. Studies in human interaction. Educational Publication Series, Michigan State University, East Lansing, Michigan, 1967
LAZARSFELD, Paul F. An unemployed village. Personality and Character, 1933
LAZARSFELD, Paul F. An episode in the history of social research: A memoir. In D. Fleming and B. Bailyn (Eds.) The intellectual migration: Europe and America 1930–1960. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969.
LUMMIS, T[revor] Structure and validity in oral evidence. Papers presented to the international Oral History Conference, Vol. I., University of Amsterdam, 1980.
MacIVER, R[obert] M[orrison] The ramparts we guard. New York: Macmillan, 1950.
MANNHEIM, K. Wissenssoziologie. Berlin 1961.
MERTON, R.K., COLEMAN, J.S. and ROSSI, P[eter] H[enry] (Hg.) Qualitative and quantitative social research. Papers in honour of Paul F. Lazarsfeld. New York: The free Press, 1979.
MILLER, C[urtis] and BUTLER, E[dgar] Anomia and eunomia: A methodological evaluation of Srole's anomia scale. American Sociological Review, 1966, 31, 400–405.
MOELLER, M[ichael] L[ukas] Eine Gegenbewegung zur Vereinzelung und Unpersönlichkeit. Frankfurter Rundschau, 2. Mai 1981.
MORRISON, D[avid] E[dward] Kultur and Culture: The case of Theodor W. Adorno and Paul F. Lazarsfeld. Social Research, 1978, Vol. 45, 2.
100
National Institute of Mental Health: A guide to medical and self-care and self-help groups for the elderyl. Washington, D. C.: 1979.
NEURATH, P[aul], Paul Lazarsfeld, 1901–1976. Unveröffentlichtes Papier des Institutes für Soziologie, Universität Wien, kein Datum.
POLLAK, M[ichael] Paul Lazarsfeld: A socio-intellctual biography. Manuskript für das Lazarsfeld-Symposium, Institut für Höhere Studien, Wien, Juni 1981.
ROBINSON, D[avid] Report of a brief field visit to look at self-help projects in Munich and Zagreb. Unpublished paper, 1978.
The self-help component of primary health care. Unpublished paper, Jan. 1979.
SILVERMAN, P[hyllis] R[olfe] Mutual help groups: A guide for mental health workers. Washington, D. C.: NIMH Publications, 1978.
SMITH, C[onstance] and FREEDMAN, A[nne] Voluntary associations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1972.
SPIRA, L[eopold] Feindbild Jud'. Wien: Löcker, 1981.
SROLE, L[eopold] Social integration and certain corrolaries: An exploratory study. American Sociological Review, 1956.
SROLE, L[eo] et al. Mental Health in the metropolis. The Midtown Manhattan Study. Revised and enlarged edition. New York: Harper & Row, 1975.
SROLE, L[eo] and FISCHER, A[nita] K[assen] The Midtown Manhatten longitudinal study vs. the ›Mental paradise lost‹ doctrine: A controversy joined. Prebublication draft, September 1979.
STUHLPFARRER, K[arl] Antisemitismus, Rassenpolitik und Judenverfolgung in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg in: Das österreichische Judentum. Wien, Jugend und Volk, 1977.
World Health Organization. Research and action for the enhancement of the psychological dimensions of health. Unpublished paper, no date.
101
ZEISEL, H. Die Wiener Jahre von Paul Lazarsfeld. Die Zukunft, 1980.
102
8. Appendix
Fliesswasserbrunnen
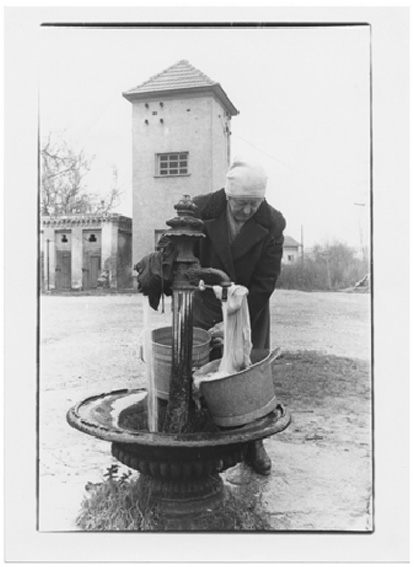
103
Schuppen im Hinterhof
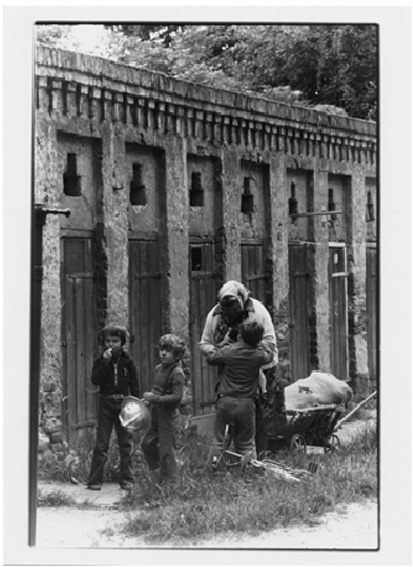
104
›Entry‹-Problematik; Kinderphoto (Originalgrösse)

105
Kinderfragebogen (Rückseite der Kinderphoto-Kopien)
ARBEITSGRUPPE
MARIENTHAL 1930–1980
|
Schweighofergasse 8/2/20 |
|
|
A–1070 Wien |
A–2440 Gramatneusiedl- |
|
(0222) 93 23 23 |
Marienthal |
FRAGEBOGEN
Wie heisst Du?Silvia
Wie alt bist Du? 14
Wieviele Geschwister hast Du? 1 Schwester (12 J.)
Wo wohnst Du?
Was möchtest Du einmal werden? Bankangestellte
Wenn Dir eine gute Fee drei Wünsche erfüllen würde,
|
Was würdest Du Dir wünschen? |
|
|
|
Stereoanlage |
|
|
Freund (treuen) |
|
|
Gesundheit |
NICHT VERGESSEN: DIESEN ZETTEL SO BALD WIE MÖGLICH IN DIE HAUPTSTRASSE 58 BRINGEN!
106
Kinderphotos


107
Kinderphotos; Ausstellung in der Hauptstrasse

108
Kinderphotos; Ausstellung in der Hauptstrasse
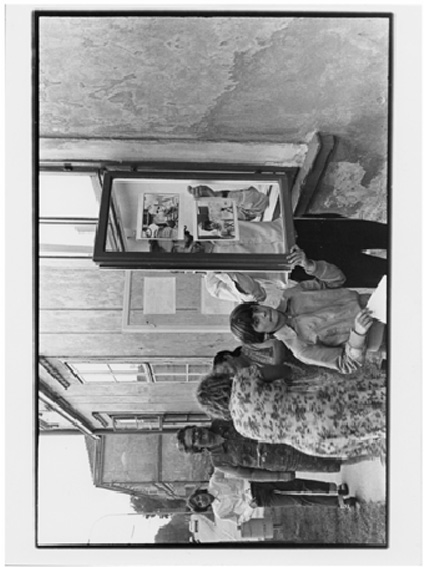
109
Medienarbeit (1): Bericht im Gramatneusiedler Gemeindeforum, Nummer 3, Dezember 1979
Die Arbeitsgruppe Marienthal berichtet:
Geschichten aus dem »Herrenpark«
»Komm in den totgesagten Park, und schau!«
(Stefan George)
In den Erinnerungen der Marienthalerinnen und Marienthaler taucht immer wieder der »Herrenpark« auf und alle sind ein bißchen traurig, dass der Park jetzt so verwildert ist und man ihn nicht mehr benutzen kann. Wir haben hier zusammengestellt, was wir über den Park in Erfahrung bringen konnten.
In dem Buch von Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel »Die Arbeitslosen von Marienthal« (1933) wird der Park zweimal erwähnt: »Gegenüber der Fabrik liegt der große, einstmals herrschaftliche Park. Auf ihn waren die Marienthaler sehr stolz. Am Sonntag waren sie auf den Bänken in der Allee mit den sorgfältig geschnittenen Sträuchern gesessen, waren auf den gepflegten Wegen spazieren gegangen. Jetzt ist der Park verwildert: Unkraut wuchert auf den Wegen, die Rasenflachen sind zerstört. Obwohl fast jeder Marienthaler Zeit dafür hätte, kümmert sich niemand um den Park.« (S. 56) Ein Marienthaler Arbeiter, der wie die meisten um diese Zeit arbeitslos war, berichtet 1932 wie er tagsüber seine Zeit verbringt: »13 bis 14 Uhr: nach dem Essen wird die Zeitung durchgesehen; 14 bis 15 Uhr: bin ich hinunter gegangen; 15 bis 16 Uhr: bin ich zum Treer gegangen; 16 bis 17 Uhr: beim Baumfällen zugeschaut, schade um den Park.« (S. 86)
Um diese Zeit wurde der Park also schon teilweise abgeholzt. Noch heute schwärmen viele von dem schönen Park: »Der Herrenpark, das war ein wunderbarer Park und jetzt ist das eine Wildnis. Da war sogar ein Tennisplatz. Um die Kastanienallee ist es wirklich schade, die ging vom Tor bis ganz hinunter, und auf den Bänken haben immer Leute gesessen. Nach der Arbeit sind die Leute in den Park gegangen, das war dann ein bißchen Erholung. Jetzt gibt es so etwas nicht mehr. Der Park war so richtig ein Erholungszentrum, am Wochenende sind die Leute von Wien herausgekommen, um in den Park zu gehen. Außer den Tennisplätzen gab es eine wunderschöne Kegelbahn, ein Waffenmuseum, Obstbäume und einen schönen Teich.« Was ist dann mit dem Park geschehen? »Man hat den Park so richtig verschleudert. Wir wußten damals, dass in dem Todesco-Denkmal, das ist ja heute auch schon ›geköpft‹, hinter einer Platte eine Urkunde mit Widmung eingemauert war. Auf dieser Urkunde stand, dass der Park den Arbeitern von Marienthal gewidmet war. Aber die Platte war herausmontiert und die Urne war verschwunden. Noch heute sieht man die Schienen und den Rand,

110
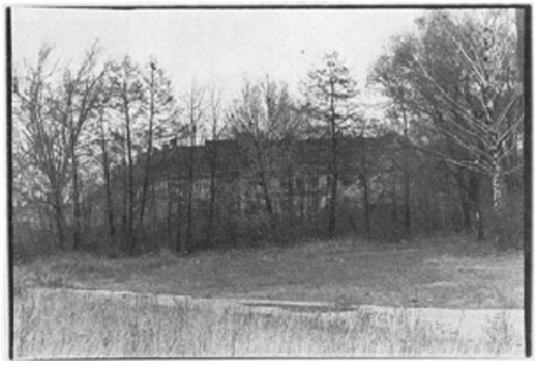
wo die Urne einmal gestanden hat. Der Park hat 1929/30 für nur 2000 Schilling den Besitzer gewechselt. Die Eschenbäume, die verkauft worden sind, haben das Tausendfache von dem Preis wieder eingebracht, für das Holz, das der Hitler für seine Gewehrkolben gebraucht hat.«
Der Teich ist dann zugeschüttet worden, dadurch ist eine andere wichtige Funktion des Parkes unterbunden worden: er war ein Teil des Marienthaler Kanalisationsnetzes: »Die Kanalisation wurde so gemacht, daß die öffentlichen Klos ständig mit Wasser durchspült wurden, und wenn das Wasser so etwa über einen Kilometer durch den Teich und die frische Luft geflossen ist, dann war das fast wie eine biologische Kläranlage. Die Brunnen, zum Beispiel, haben ja auch gleichzeitig zur Durchwässerung und zur Reinigung der Kanäle beigetragen und darum sind sie Tag und Nacht gelaufen.«
Der Park hat auch politisch eine bewegte Geschichte. Ein Marienthaler erzählt vom 1. Mai 1934: »Da haben wir auf dem Teich ein Boot schwimmen lassen, und zwar so, daß man es nicht gleich erreichen konnte. Da stand ein Galgen drauf mit einer Tafel ›DEM VOLKE‹, weil man ja damals die Leute, die beim Schutzbund mitgemacht haben, verfolgt hat. Das hat sich ganz schnell herumgesprochen in Marienthal. Und ein andermal haben wir auf die Dächer und auf die Bänke im Park und auf den Tennisplatz mit roten Buchstaben geschrieben: ›Es lebe die Vierte Internationale!‹ Die Gendarmen haben beordert, daß wir die Schrift. sofort entfernen. Und da haben wir die Schrift einfach sorgfältig mit schwarzer Farbe übermalt und man hat es natürlich immer noch lesen können.«
Der Park wurde also verkauft und parzelliert, einen Teil hat die Gemeinde erworben, der Teich wurde aufgefüllt, die Bänke sind zu allerletzt verschwunden, das Holz ist zum Teil in den Wohnungen zum Heizen benutzt worden. »Aber so bis 1945 war der Park noch halbwegs intakt, die Russen haben ihn dann zusammengedroschen. Aber eigentlich ist das ganze Gelände des Parks ja noch da!«
Eine Marienthalerin sagt: »Es wäre so schön, wenn wir eine Grünanlage in Marienthal hätten. Da ist nirgends eine Bank, oder nur direkt an der Straße. Aber wenn man weiter hinausgeht, kann man sich nirgends niedersetzen. Der Park könnte doch wieder hergerichtet werden, den müßte man ausholzen und wieder ganz neu anlegen.«
Die Kinder spielen natürlich nach wie vor im Park, wie ihre Eltern, als sie klein waren, »Fischergarten« nennen sie ihn jetzt. Die Kinder haben ein kleines Haus gebaut, und im Frühling wollen sie sogar ein Baumhaus in den Wipfeln bauen. Der Park ist noch immer wunderschön mit ein paar herrlichen, alten Bäumen. Kennen Sie die alte Birke, die mitten im Gelände steht? Natürlich gibt es auch viel unwegsames Gestrüpp, das ist schön für Abenteuerspiele, aber macht sonst den Park zu einer undurchdringlichen Wildnis. Ob man da etwas andern könnte?
111
Medienarbeit (2): Videovorführung in der Hauptschule

112
Medienarbeit (3): Vorführung der Videodokumentation im Gramatneusiedler Vorführsaal

113
Medienarbeit (4): Vorführung der Videodokumentation in Marienthal; Diskussion mit Prof. Marie Jahoda

114
Ein neues Vorwort?
TEXTIL
ABRUPTES ENDE?
Nur ein Verkauf in letzter Minute kann die Weberei der Pottendorfer Textilwerke noch retten.
Für die 388 Beschäftigten der Pottendorfer Textilwerke entscheiden die nächsten Wochen über Sein oder Nichtsein. Ersteres gilt für einen Teil nur wenn ein neuer Eigentümer gefunden wird; letzteres ist zumindest für die 225 Mitarbeiter in der Weberei die zwar unangenehmste, aber wahrscheinlichste Lösung.
Denn die Manager der »Verwaltung von Textilunternehmen und Handels GmbH«, die im Industriekonzern der Creditanstalt (CA) seit 1977 als Holding die Beteiligungen an den Textilunternehmen Hitiag und Pottendorfer verwaltet, scheinen – sichtlich mit Genehmigung seitens der Creditanstalt – fest entschlossen, die Verlustquellen endgültig zu beseitigen.
Und dazu gehört, sofern nicht in letzter Minute ein Käufer auftaucht, auf jeden Fall die abrupte Schließung der Weberei – »stufenlose Stillegung«, wie es in der CA elegant umschrieben wird.
Bessere Aussichten haben da die 163 Beschäftigten in der Spinnerei im niederösterreichischen Felixdorf. Denn immerhin wurden dort von den Eigentümern während der letzten zehn Jahre rund 380 Millionen Schilling investiert; davon gut 60 Millionen während der letzten drei Jahre. So daß die Anlage heute als hochmoderne Spinnerei gilt, die allerdings bisher dennoch keine Gewinne erwirtschaften konnte.
Jedenfalls reicht es aber dazu aus, daß potentielle in- und ausländische Käufer zumindest Interesse zeigen. Sollte es in absehbarer Zeit aber zu keinem Abschluß kommen, so dürfte die Spinnerei dennoch weitergeführt werden.
Die Textilgruppe der CA war schon in den letzten Jahren als problembeladen ebenso bekannt, wie der Großteil der Branche geradezu mit der Krise lebt. Dennoch ist es bei der Hitiag gelungen, wenigstens Gewinne zu erwirtschaften – wenn auch dividendenlos. Gleichzeitig schrumpfte der Beschäftigtenstand aber von 750 im Jahre 1979 auf heute 470.
Bei der Pottendorfer arbeiteten 1979 noch 600 Personen. Doch auch der Personalabbau war offensichtlich kein Rezept; die Umsätze gingen von 350 Millionen Schilling auf etwa 300 Millionen 1981 zurück. Mit Bettwäsche, Baumwollstoffen und Elastikgeweben ist, so scheint's, eben kein Geld mehr zu verdienen.
115
Über die Mitarbeiter
Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft und Medientheorie in Frankfurt, Wien und New York; M.A. 1979, City University of New York.
Studium der Psychologie und Soziologie in Wien, Heidelberg und New York; Ph.D. 1978, Columbia University.
Studium der Soziologie und Psychologie in Wien und New York; Ph.D. 1976. Columbia University; Filmstudium; M.F.A. 1979, Columbia University.
Elizabeth Sacre:
Studium der Pädagogik und Literaturwissenschaft in Brisbane, New Haven und New York; Ed.D. 1979, Teachers College, Columbia University.
Die genannten vier Autoren arbeiten seit 1976 als Mediengruppe Sync an dokumentarischen und sozialwissenschaftlichen Projekten.
Martin Adel:
Studium der Germanistik und Philosophie in Wien; Dr. phil. 1980, Universität Wien.
Edith Haas:
Studium der Psychologie und Soziologie an der Universität Wien.
Gerhild Ohrnberger:
Studium der Soziologie und Ethnologie an der Universität Frankfurt; Diplom in Soziologie 1976.
116
Robert Schächter:
Studium der Psychologie und Soziologie an der Universität Wien; Statistiker und Datenanalytiker.
Anschrift:
Arbeitsgruppe Marienthal 1930 bis 1980